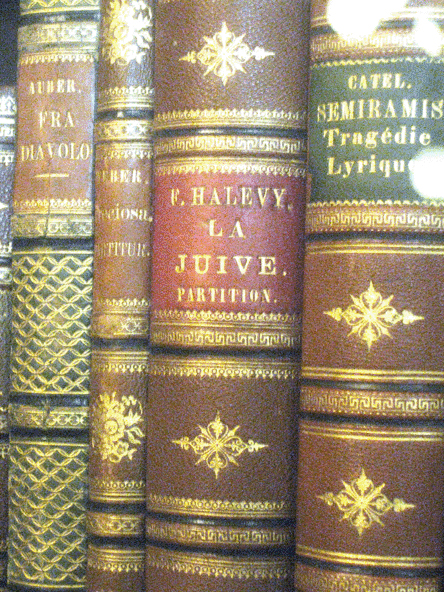|
Bemerkungen zur szenischen Umsetzung
von
'Die Jüdin'
Fromental Halévy (1799 – 1862)
Oper in fünf Akten
Libretto von Eugène Scribe (1791 - 1861)
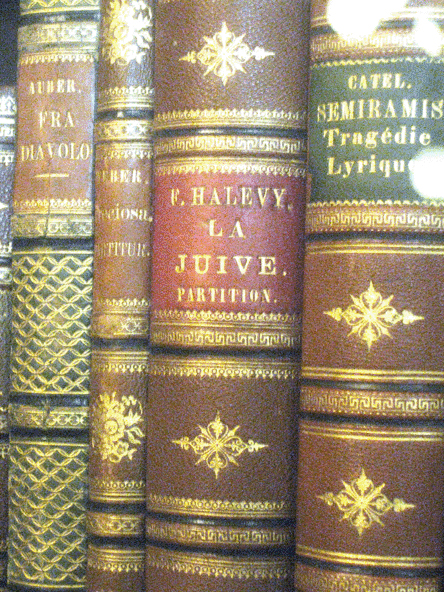
Rücken der Partitur 'Die Jüdin'
in der Bibliothek Richard Wagners in Villa Wahnfried in Bayreuth
neben den Noten von 'Fra Diavolo', 'Preciosa' und 'Semiramis'
| |
Zitat
Stofflich steht La
Juive auf dem Boden von Lessings Nathan und Scotts Ivanhoe und ist
bereits vom Textbuch her ein echtes Produkt ihrer Zeit. Besonders in
den jüdischen Ritualszenen (Gebet, Brotweihe, Osterfeier) vermochte
Halévy den dunklen Seiten der Handlung ein glaubhaftes und wirksames
musikalisches Gepräge zu verleihen. Dennoch zeigt sich auch schon in
La Juive seine Unfähigkeit, große dramatische Zusammenhänge packend
zu gestalten (Finale 5. Akt). Die pathetische Vaterrolle der Oper
wird von einem Tenor dargestellt; dies geht auf den Einfluss des
Sängers Nourrit zurück, der auch Meyerbeer veranlasst hat, dem
ursprünglichen Schlusschor des 4. Aktes seiner Hugenotten ein
Liebesduett folgen zu lassen.
Im Ganzen gesehen ist die musikalische Sprache der ernsten Opern
Halévys, die in La Juive durch Verwendung jüdisch nationaler
koloristischer Effekte fesselnde Reize ausübt und an manchen Stellen
(Romanze der Recha und Arie des Eleazar) Töne von ergreifender
Schönheit anschlägt, recht monoton.
Die zu den Solopartien der Oper kontrastierenden Chöre und Ballette
sind musikalisch die schwächsten Stücke des Werkes.
In seinen folgenden Opern ernsten Charakters, von denen Guido ei
Ginevra mit seinem wollüstigen Spiel um Liebe, Gift und Mord zu den
brutalsten Auswüchsen romantischer Reizbarkeit gehört, versuchte
Halévy immer mehr, sich die Technik und den Stil Meyerbeers
anzueignen und alle vokalen und instrumentalen Ausdrucksmittel zu
erschöpfen. Dabei überschätzte er seine Begabung und übersah. wo
sein eigentliches Talent lag. Mit der zunehmenden Stilangleichung an
Meyerbeer gingen die Vorzüge von La Juive, zu denen außer der
zwingenden Gestaltung festumrissene Charaktere der Eindruck einer
immer noch persönlichen musikalischen Sprache gehörte, immer mehr
verloren. In seinen letzten ernsten Opern sind die Chöre nur noch
Staffage und haben an der dramatischen Handlung kaum Anteil; die
Solopartien überschreiten mehr als einmal die Grenze zum
Sentimentalen oder zum leeren Pathos. Halévys eigentliche Begabung
lag auf dem Gebiet der opera comique.
Seine komischen Einakter und Vollopern stehen zwar durchaus nicht
alle auf derselben Höhe, doch schließen sich einige von ihnen würdig
der von Auber und Boeldieu vorgezeichneten Linie an.
Zitatende
Quelle: Wilhelm Pfannkuch in MGG - Seite 1347
|
|
Zitat
Nds. Staatsoper Hannover
Zitat
Inhalt
Wieviel Offenheit
erträgt eine Gesellschaft in politisch aufgeladenen Zeiten? Der
Konflikt, der sich im ausgehenden Mittelalter zwischen einem
Kardinal und einem jüdischen Goldschmied entfaltet, wird zum
gesellschaftlichen Sprengstoff, der mitten ins Herz der
Toleranzvorstellungen auch unserer Zeit trifft.
Konstanz 1414: Während der verbitterte Jude Éléazar bereit ist,
seine Tochter zu opfern, kommt sein Gegenspieler Kardinal Brogni
schnell an die Grenzen der eigenen Nächstenliebe. Keiner von beiden
wird die Vorgeschichte aus Kränkungen und Schicksalsschlägen los,
denn immer wieder spielt sich ein populistisch gelenktes Volk in den
Vordergrund und verlangt Rechenschaft.
Halévy zeigt in seiner großen, 1835 in Paris uraufgeführten Oper die
Reibung zwischen Menschen, die den Anderen in seiner Fremdheit nicht
mehr gelten lassen können.
Jede Figur ruft Gott an – und jede meint einen anderen. Auf
raffinierte Weise bündelt La Juive diesen Widerspruch in der Musik.
Die Demokratie testet auf der Bühne ihre eigene Toleranz, das
Theater beweist seine Fähigkeit, Ort des politischen Diskurses zu
sein.
•
Am Pult des Staatsorchesters leitet Constantin Trinks die opulenten
Chorszenen und virtuosen Arien des Stücks. Der Dirigent ist
regelmäßiger Gast an den großen Opernhäusern der Welt und arbeitete
zuletzt an der Seattle Opera, an der Bayerischen Staatsoper und am
Teatro dell’Opera di Roma. Als Éléazar ist der stimmgewaltige Tenor
Zoran Todorovich zu erleben.
In den Händen des Teams um Regisseurin Lydia Steier entsteht ein
komplexer Bilderbogen mit doppelten Böden. Steier, deren
Inszenierung von Karlheinz Stockhausens Donnerstag aus Licht in
Basel von der Fachzeitschrift „Opernwelt“ zur besten Aufführung des
Jahres 2016 gewählt wurde, zeigt eine anspielungsreiche Zeitreise,
bei der die Uhren rückwärts gehen und von der heutigen Epoche der
Massenmedien bis auf den Grund der Neuzeit führen. Dabei sucht sie
die Brisanz der Geschichte: Wie weit kann die gesellschaftliche
Assimilierung von Menschen aus anderen Kulturen gehen? Wo liegen die
Quellen der Klischeebilder in unserem Kopf? Vom Jahre 1414 aus
stellt sich neu die Frage: Sind sie immer noch darinnen?
Zitatende
Quelle: Homepage der Nds. Staatsoper Hannover GmbH
|

War das Judentum in Europa von
Ausgrenzung gekennzeichnet, so änderte sich ihr Status mit der
Französischen Revolution. Die konstituierende Nationalversammlung in
Paris grenzte Juden aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte
vom 26. August 1789 aus und man diskutierte heftig darüber, ob man
sie einbürgern oder vertreiben solle. 1791 räumte sie dann aber fast
einstimmig allen Juden Frankreichs den Status eines Bürgers (citoyen)
ein, wenn sie im Gegenzug auf ihren Status als Gemeinde
verzichteten. Dies brachte den Juden zum ersten Mal in einem
europäischen Land die Bürgerrechte. Sie verloren dafür ihre
bisherige Teilautonomie und mussten Militärdienst leisten.
So ist es kaum verständlich, dass im Jahr 1835 eine Oper in Paris
aufgeführt wurde, die sich mit dem Gegensatz von Juden- und
Christentum beschäftigte.
Oder wollte man zeigen, wie es war, als Juden verfolgt, aus
nichtigen Gründen zum Tode verurteilt und auch hingerichtet
wurden, um der Bevölkerung vorzuführen, dass die Vernichtung des
Judentums unter dem Aspekt der Aufklärung als nicht mehr zeitgemäß
fortgeführt werden konnte. Ob hier schon früher ein Einfluss
Friedrich II. über Voltaire gegeben sein könnte, ist nicht
nachzuweisen. Preußens Einstellung, jeder könne nach seiner Facon
selig werden, kann, aber muss nicht zwangsläufig und langfristig die
Franzosen schon früh beeindruckt haben, wenn denn erst in der
Nachfolge der Revolution von 1789 eine Änderung der Einstellung zur
Problematik und gesetzliche Regelungen die Ausgrenzung beendeten.

Eugène Scribe betrieb in Paris eine
Fabrik zur Erstellung von Opernlibretti.
Le comte Ory (Gioachino
Rossini),
Die weiße Dame (François-Adrien
Boïeldieu)
Die Stumme von Portici
(Daniel-François-Esprit Auber)
Fra Diavolo
(Daniel-François-Esprit Auber)
Dom Sébastien (Gaetano
Donizetti)
Les vêpres siciliennes
(Giuseppe
Verdi),
Gustave III. ou Le bal masqué
(Daniel-François-Esprit Auber)
(Vorbild für Verdis
Maskenball)
Robert der Teufel (Giacomo
Meyerbeer)
Die Jüdin (Jacques
Fromental Halévy)
Die Hugenotten (Giacomo
Meyerbeer)
Der Schwarze Domino
(Daniel-François-Esprit Auber)
Manon Lescaut
(Daniel-François-Esprit Auber)
Der Prophet (Giacomo
Meyerbeer)
Die Afrikanerin
(Giacomo Meyerbeer)
Barkouf (Jacques
Offenbach)
Die verwandelte Katze
(Jacques Offenbach)
Neben diesen Texten für die Oper ließ
er in seinem Büro allein für das Théatre Madame noch 150
Intrigenkomödien erstellen, wobei er - basierend auf einem genauen
Arbeitsplan - die Grundidee des Stückes, das Szenarium, die
Personen, die Verse, den Dialog, die Aktschlüsse oder weitere
Spezialteile ausarbeiten ließ.
Dass es bei der Erstellung der Libretti zuweilen drunter und drüber
ging und seltsame Konstrukte auf die Bühnen kamen, lässt sich auch
bei der 'Jüdin' feststellen.
Da ist der Konflikt zwischen den Religionen, dann die Amoure der
'Jüdin', die in Wirklichkeit eine Christin ist und die mit einem
Kunstmaler, der sich als Jude ausgibt, aber ein Christ ist und vom
Text her mal als Verlobter, dann als Gemahl der Prinzessin Euxenia,
der Nichte des Kaisers, ausgewiesen wird, die diese Affäre hat, wie
auch die Konstruktion, die der 'Jüdin' einen Vater zuordnet, der er
garnicht ist, sondern der eine Jude ist, der sie als Tochter des
Kardinals aufzieht und die er opfert, um seine Rache an den Christen
zu befriedigen und die von den Konstanzern als 'Jüdin' dann
hingerichtet wird.
Scribe wollte unterhalten und nicht unbedingt das Leben
widerspiegeln. Da kam es nicht darauf an, wer, mit wem, wann.
Diesen Anspruch erhebt nun unter neuer Leitung die Nds. Staatsoper
Hannover. Man wolle im Fall der 'Jüdin' die Historie zur Geltung
kommen lassen, daher auch die üppige Ausstattung der Produktion, in
der das Werk spielt - es fehlten nur die Pferde. Hunderte von
Kostümen und Perücken seien auf der Bühne zu sehen, getragen von
Solisten, Chor und Kinderstatisten, die aber heitere Auslegungen der
Handlung möglich machen werden.
Hieraus schließend die Erkenntnis:
Man könne gerne Gemüse essen, es käme aber darauf an, wie es
zubereitet ist - so die Regisseurin des Werkes Lydia Steier, die ja
mit Erfahrungen vom Broadway nach Regensburg kam, um dort 'The fairy
Queen' und 'Saul', bei dem allerdings die szenische Aufarbeitung mit
'too much' kritisiert wurde, zu produzieren.

Das Konzil zu Konstanz,
Jan Hus und die Hussiten
Zwischen 1414 und 1418 kamen Tausende
Gesandte, Bischöfe, Gelehrte und Fürsten in der Bodensee-Stadt zusammen.
Ziel der Versammlung war es, die damalige Kirchenspaltung zu überwinden.
Seit 1378 war die abendländische Christenheit gespalten; zeitweise
bekämpften sich drei Päpste und deren jeweilige Unterstützer.
Vor allem auf Druck und durch den Einfluss des deutschen Kaisers Sigismund
(1411-1437) gelang in Konstanz mit der Wahl von Papst Martin V. (1417-1431)
ein Neuanfang. Zudem vereinbarten die Konzilsteilnehmer, kirchliche
Reformfragen künftig in regelmäßigen Abständen bei einem Konzil zu beraten -
eine Idee, die sich jedoch später gegen wiedererstarkende Päpste nicht
durchsetzte.
Der böhmische Reformator und
Kirchenkritiker Jan Hus folgte in seinen
Überlegungen John Wyclif, einem englischen
Philosophen,
Theologen und Kirchenreformer, der den
politischen Machtanspruch des Papstes bestritt. In seinen Werken von 1372
bis 1380 (Von der Kirche, Von der bürgerlichen Herrschaft und
Vom Amt des Königs) vertrat er die völlige Unterordnung der Kirche
unter den Staat.
Am Konzil zu Kostanz wurde am 6. Juli 1415 beschlossen, Wyclif für seine
Thesen nachträglich zu bestrafen und zu exhumieren. Dies gehört zu den
schändlichsten Vergehen des Konzils, dass die Kirche die Ablehnung des
Irrtums mit der Vernichtung des Irrenden verbindet und nicht einmal die
Toten ruhen lässt.
Jan Hus kämpfte gegen den Ablasshandel, mit dem sich schon Thomas von Aquin
in seiner Lebenszeit von
1225
und dem
7. März
1274
auseinandersetzte. Eine päpstliche
Ablassbulle hatte er scharf attackiert - sich gegen den Klerus und gegen die
uneingeschränkte Macht des Papstes gewandt.
Auf dem Konstanzer Konzil sollte er seine Thesen erläutern. Hierzu kam es
nicht, er wurde festgenommen, vegetierte unter unwürdigen Bedingungen im
Kerker und wurde auf einem Scheiterhaufen vor den Toren der Stadt Konstanz
am 6. Juli 1415 verbrannt, obwohl ihm Sigismund, vor seinem feierlichen
Einmarsch als Kaiser in die Stadt des Konzils am 24. Dezember 1414, freies
Geleit in Aussicht gestellt hatte. So wurde er zu einem der ersten Märtyrer
und Wegbereiter der späteren Reformation.
Nach dem Tod des Reformators sammelten sich seine Anhänger, die Hussiten,
die von den meisten böhmischen Adeligen unterstützt wurden und sich
hauptsächlich gegen die böhmischen Könige, die damals gleichzeitig das Amt
des römisch-deutschen Kaisers bekleideten, und gegen die römisch-katholische
Kirche richteten. Infolge der Auseinandersetzungen kam es in den Jahren
1419–1434 zu den Hussitenkriegen.

Die Produzenten der Nds. Staatsoper Hannover
GmbH hielten es für richtig, das Stück 'Die Jüdin', das im Original eine
zeitliche und räumliche Einheit bildet, ohne Angabe von Gründen für diese
Änderung, in fünf Teile zu zerlegen.
1. Akt - USA in den 1950er Jahren
2. Akt - Deutschland 1929
3. Akt - Stuttgart 1738
4. Akt - Iberische Halbinsel 1492
5. Akt - Konzil zu Konstanz 1414
Möglicherweise sah man das ursprüngliche Konzept, nach dem das Stück im
Rahmen eines Inquisitionsprozesses im indischen Goa spielen sollte als
Hinweis, auch Zeit und Ort ändern zu dürfen. Ob aber bei damaligem Konzept
auch eine Teilung der Locations mit Delhi und Madras und Agra und sonstigen
Stätten eingeplant war, ist nicht bekannt.
In Hannover sollte wohl der Antisemitismus über die Jahrhunderte bis ins
Heute vorgestellt werden.
Leider wurde durch die Beschränkung auf die in der Inszenierung angegebenen
Zeiträume versäumt, auf die unmittelbare Aktualität hinzuweisen, dass man
heute in Deutschland auf der Straße keine Kippa mehr tragen kann, ohne
angepöbelt zu werden. Spielende und sich bekämpfende Gassenjungen wie auf
der Bühne in Hannover weisen die Problematik nicht ausreichend aus.
Das Stück ist persé schon schwierig zu verstehen und wer in Hannover kein
Programmheft kauft und durch seinen Sitz vom Übertitel abgehängt ist (nicht
von allen Plätzen ist die Übertitelung einsehbar), kann allem nur anhand der
optischen Äußerlichkeiten folgen.
Bei dieser Verzettelung in Zeit und Raum geht die Einstellung des Juden
Éléazar, 'Auge um Auge, Zahn um Zahn' und damit für ihn Genugtuung walten zu
lassen und seine Vergeltungsansprüche durchzusetzen, verloren, kann nicht
deutlich werden. Man sieht und hört nur den gequälten Menschen jüdischen
Glaubens - seine Verwünschungen können dank Französischer Sprache und
mangelnder Darstellungsfähigkeit nicht vermittelt werden.
Wie überdeutlich wird die Problematik in der Übersetzung:
ÉLÉAZAR
Doch vorher, kurz vorher
Nehm an einem Christen Rache ich,
Rache ich! - Nehme sie an dir!
ÉLÉAZAR
Nicht seine Duldung, seine Güte
Versöhnet meinen Rachegeist.
Haß und Verderben jedem Christen,
Wenn er auch Duldung uns verheißt.
ÉLÉAZAR
Ich vollzieh meine Rache,
Ich bin's, der dich verdammt,
Zu erdulden ew'ge Qual! -
Es lastet nun auf dir
Der Haß, den ich genähret
ÉLÉAZAR
Ha, Raserei, unsinnige Rache! ich fröhne dir,
Und opfre rücksichtslos mein Kind!
Er gibt sich im Schlussbild ganz brutal seiner Rache hin, lässt lieber die
Ziehtochter Recha in den Tod gehen, als den leiblichen Vater darauf
hinzuweisen:
Hier ist dein Kind, das du in den Tod schickst. Rette
es!
Das Aufzeigen dieses mörderischen Verhaltens in der Oper ’Die Jüdin’ -
besonders in diesen Tagen eines Wiederaufflammens eines verstärkten
Antisemitismus in Deutschland – stellt das Projekt in Frage, da es zu
Irritationen in der Bevölkerung führen kann.
Zitat
Stand: 20.05.2019
12:43 Uhr
Angriff auf Haus eines jüdischen
Ehepaares
Nach einem Brandanschlag auf das Haus eines jüdischen Ehepaars in
Hemmingen (Region Hannover) haben die Ermittler noch keine Hinweise auf
die Täter. Laut Staatsanwaltschaft hatten Unbekannte in der Nacht zu
Sonnabend vor der Haustür des Paares im Stadtteil Westerfeld ein Feuer
gelegt. Zudem wurde auf das Gebäude mit roter Farbe das Wort "Jude"
aufgesprüht. Auch das Eingangstor zu einem nahe gelegenen Schrebergarten
des Paares wurde mit dem Schriftzug beschmiert.
Zitatende
Quelle: NDR
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Angriff-auf-Haus-eines-juedischen-Ehepaares,hemmingen152.html |
Das Publikum ist aber hier in der Nds. Staatsoper Hannover ganz gefangen vom
Spektakel auf der Bühne und damit abgelenkt vom sich rächenden Juden, schaut
auf den hereingerollten Kessel mit sprudelndem Wasser, in das Recha
tatsächlich eintaucht, Luft schnappt, wieder untergeht, bis das Licht auf
der Bühne ganz plötzlich ausgeschaltet wird, das Orchester schweigt und die
Oper auf einmal zu Ende ist.
Fazit:
Seit mehr als 15 Jahren gab es nicht mehr einen solchen Jubel im
vollbesetzten Haus. Das Publikum verstand zwar in großen Teilen die Story
nicht, und wenn doch, sah es über Albernheiten auf der Szene hinweg wie
beispielsweise hier:
"Huch, Du siehst mich nicht!"

Screenshot Nds. Staatsoper Hannover - Foto Sandra Then
Man ignorierte stimmliche Mankos, bewertete
die Action der Show positiv und war angetan vom engagierten Einsatz von
Solisten, Chor, Statisten, Orchester und Technik.
Man sah sich endlich den Zeiten der das Publikum vertreibenden Intendanten
Puhlmann und Klügl enthoben.
Das künstlerische Elend an der Nds. Staatsoper Hannover scheint ein Ende zu
haben. Allerdings macht eine Schwalbe noch keinen Sommer.


Aus
den Medien
Zitat
Staatsoper Hannover eröffnet Saison
mit "La Juive"
In den Hauptrollen sind die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva
(Rachel), der aus Serbien stammende Tenor Zoran Todorovich (Élézar), der
US-amerikanische Tenor Matthew Newlin (Léopold), die argentinische
Sopranistin Mercedes Arcuri (Prinzessin Eudoxie) und der georgische Bass
Shavleg Armasi (Kardinal Brogni) zu erleben. Am Pult des
Niedersächsischen Staatsorchesters steht der deutsche Dirigent
Constantin Trinks.
Zitatende
Quelle: Musik - 14.9.2019
http://www.musik-heute.de/20061/staatsoper-hannover-eroeffnet-saison-mit-la-juive/ |


Zitat
Halévys Oper
„Die Jüdin“ in Hannover
„Musikalisch à la bonne heure“
Uwe Friedrich im Gespräch mit Marietta Schwarz
Unseren Kritiker Uwe Friedrich hat die Inszenierung überzeugt: „Auf
jeden Fall ein hörens- und sehenswerter Abend.“
[...]
Insgesamt sei er sehr glücklich über die musikalische und gesangliche
Umsetzung. So lebendig, so energetisch habe er diese Musik noch nicht
gehört: „Musikalisch à la bonne heure.“ Eine kleine Einschränkung gibt
es allerdings: Manche Szenen seien arg kitschgefährdet gewesen, urteilt
Friedrich.
Zitatende
Quelle: DLF - 14.9.2019
https://www.deutschlandfunkkultur.de/halevys-oper-die-juedin-in-hannover-musikalisch-a-la-bonne.1013.de.html?dram:article_id=458842 |


www.bi-opernintendanz.de
|