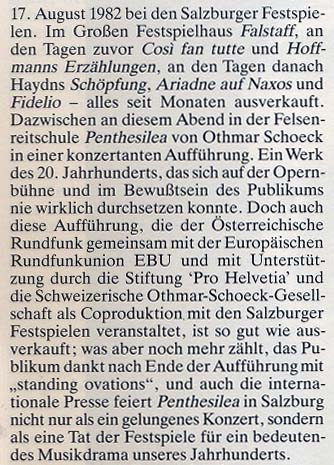Othmar Schoeck
'Penthesilea'
Salzburg 1982
Musikalische
Leitung - Gerd
Albrecht
Penthesilea -
Helga Dernesch
Prothoe - Jane
Marsh
Meroe -
Mechthild
Gessendorf
Achilles - Theo
Adam
Diomedes - Horst
Hiestermann
ORF-Chor / ORF
Symphonieorchester
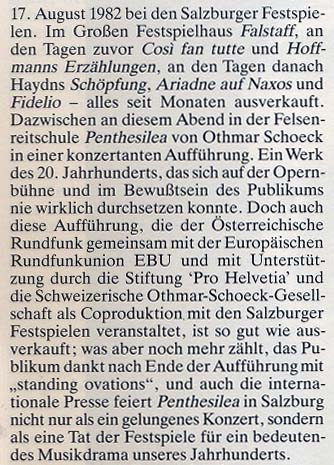
|

Nicht nur Othmar
Schoeck griff
das Thema
'Penthesilea'
auf, (am Theater
Basel wird Hans
Neuenfels das
Werk mit
Premiere am
03.11.07 neu
inszenieren)
auch Hugo Wolf
beschäftigte
sich mit der
Amazonenkönigin.
(Hugo Wolf,
Penthesilea,
Sinfonische
Dichtung,
Klavierauszug zu
vier Händen
(1903),
Lauterbach &
Kuhn, Leipzig
1903)
Neu im Kreis der
mit
'Penthesilea'
sich
beschäftigen ist Wolfgang
Rihm als
Verfasser einer
Penthesilea-Komposition.
Penthesilea
Monolog
für
dramatischen
Sopran
und
Orchester
(2005)
Text:
Heinrich
von Kleist
Uraufführung:
2005-08-20,
Weimarhalle,
Weimar
(D)
Solisten:
Gabriele
Schnaut,
Sopran
Orchester:
MDR-SO
Dirigent:
Dennis
Russell
Davies
Besetzung:
1.
Flöte;
2.
Flöte;
3. Flöte
(+Picc);
1. Oboe;
2. Oboe;
Englischhorn;
1.
Klarinette
in A; 2.
Klarinette
in A;
Bassklarinette
in B; 1.
Fagott;
2.
Fagott;
Kontrafagott;
1. Horn
in F; 2.
Horn in
F; 3.
Horn in
F; 4.
Horn in
F; 1.
Trompete
in C; 2.
Trompete
in C; 3.
Trompete
in C; 1.
Posaune;
2.
Posaune;
3.
Posaune;
Basstuba;
Pauken;
1.
Schlagzeug;
2.
Schlagzeug;
3.
Schlagzeug;
Harfe;
Klavier;
Violine
I;
Violine
II;
Viola;
Violoncello;
Kontrabass
Aus dem
Schlussstück
von
Kleists
Penthesilea
habe ich
diesen
Monolog
gezogen.
Penthesilea
und
Achilles
sind
Liebestote,
Tote
(wegen)
der
Liebe.
Ihre
Tode
sind
Liebestode.
Penthesilea
zerreißt
und isst
Achilles
(zumindest
Teile
von ihm)
und
tötet,
erkennend,
sich
selbst.
Kleist
sprengte
das in
Sprache
ein.
Erstaunlich
oft
zitiert
er
christlich
klingende
Sprachbilder
im
heidnischen
Kontext.
So wird
Penthesilea
für
Augenblicke
sichtbar
als
schmerzdurchbohrte
Pietà.
Was kann
ich da
musikalisch
überhaupt
erreichen?
Kleists
Sprache
„gerecht“
werden
kann
niemand.
Das in
dieser
Sprache
mitgeteilte
factum
brutum
entzieht
sich
jeglicher
„Behandlung“
außerhalb
dieser
Sprache.
Was also
ist
möglich,
mit
Tönen?
Nichts.
Aber ein
Versuch.
Nur das
ist
möglich.
Die
viele
Schichten
austragende
und
aufreißende
Frauenfigur
Penthesilea
in ihrer
verschlingenden
und
selbstverzehrenden
Weiblichkeit
als
Kraft
eigener
Gesetzlichkeit
vernehmbar
werden
zu
lassen –
das wäre
das
Einzige,
dem ich
mich als
einer
„Aufgabe“
stellen
könnte.
Ich
hab’s
versucht.
Wolfgang
Rihm
|
|
Viel
Beifall
fand am
20.
August
die
Uraufführung
von
Wolfgang
Rihms
"Penthesilea-Monolog"
nach
Heinrich
von
Kleist,
komponiert
für die
Sopranistin
Gabriele
Schnaut.
Sie
wurde
begleitet
vom MDR
SINFONIEORCHESTER
unter
Dennis
Russell
Davies,
dem
Chefdirigent
des
Bruckner
Orchesters
in Linz. |
|
|

Penthesilea
(1808)
ist ein
Drama
über die
Amazonenkönigin
der
griechischen
Sage,
Kleist
bekannte:
»Mein
innerstes
Wesen
liegt in
der
Amazone,
der
ganze
Schmerz
gleich
und
Glanz
meiner
Seele.«
Penthesilea,
die
»rätselhafte
Sphinx«,
liebt
Achill,
den
Helden
der
Griechen
vor
Troja,
liebt
ihn
ebenso
leidenschaftlich,
wie sie
ihn
hasst,
sie ihn
nicht
besiegen
kann,
Sie
gesteht
ihre
Liebe,
liefert
sich ihm
aus, ist
aber
gleichzeitig
über den
Verlust
ihrer
Kraft
und
ihrer
Selbstbeherrschung
von Hass
und
Scham
erfüllt.
Nachdem
sie
Achill
in
rasender
Wut
getötet
hat,
löst sie
sich von
ihrem
allzumenschlich
triebhaften
Sein,
das sie
nicht
bewältigen
konnte;
in einer
Todestrance
träumt
sie sich
in die
reine
Welt der
Götter
zurück.
Die
Frage
nach dem
Ausgleich
zischen
der
klassischen,
dem
Auftrag
der
Götter
folgenden,
innerlich
beherrschten
und der
romantisch
verzückten
Penthesilea
blieb
ungelöst.
Ihr
Konflikt
wird
beendet
durch
Entäußerung
ihrer
Liebe
und
durch
Rückkehr
zum
Olymp.
(Glaser,
Lehmann,
Lubos:
Zwischen
Klassik
und
Romantik,
1981, S. 206)
|
|

"Auf den ersten
Blick scheint
diese
verschollene
Geschichte mit
ihren Varianten
nicht besonders
reizvoll,
eigentlich
nichts als ein
Hin- und
Hergerede über
eine halb und
halb
gegenstandslose,
wilde und
blutige
Rauferei.
Aber eben das
Ungenaue der
Nachrichten und
ihre barbarische
Indifferenz
machten den
Stoff so
reizvoll für
Kleist. Es war
gerade seine,
diese tief im
Atavistischen
verwurzelte
Phantasie, derer
er bedurfte, das
Widersprüchliche
der alten
Überlieferung in
eines zu denken
und etwas
Einzigartiges
draus zu
machen."
(Joachim Maass -
Kleist - 1977,
S. 147)
|
|

Frank
Wedekind
hielt am
20.11.1911
eine
Rede auf
Kleist,
in der
er das
um die
Jahrhundertwende
erwachte
Interesse
an der
'sexuellen
Zwangsvorstellung'
in der
Penthesilea
aufgreift
und
weiterführt:
"Wenn
Heinrich
v.
Kleist
heute
seine
Penthesilea
schriebe,
dann
würde
der
Berliner
sowohl
wie der
Münchener
Zensor
die
öffentliche
Aufführung
aus
Gründen
der
Sittlichkeit
rundweg
verbieten.
Die
Penthesilea
ist die
künstlerische
Ausgestaltung
eines
Sinnesrausches,
einer
sexuellen
Zwangsvorstellung.
In
dieser
Tatsache
liegen
die
poetische
Größe
sowohl
wie die
technischen
Mängel
des
Dramas
begründet.
Die
poetische
Größe
käme
aber für
die
heutige
Zensurbehörde
gar
nicht in
Betracht,
solange
dem
Autor,
wie es
bei
Kleist
zeitlebens
der Fall
war, die
öffentliche
Anerkennung,
die
Anerkennung
der
literarischen
Autoritäten,
der
Heuchler,
Erfolgsanbeter,
Autographensammler,
Schriftgelehrten
und
Pharisäer
fehlt.
Es ist
also gar
nicht
ausgeschlossen,
daß es
Heinrich
v.
Kleist
im
heutigen
Deutschland
noch
schlimmer
ginge
als vor
hundert
Jahren."
(Nachruhm
Nr.
410b)
|
|

Döblin
hat in
einem im
Prager
Tageblatt
am 13.
2.1923
erschienenen
Aufsatz
'Die
Psychiatrie
im
Drama'
Kleists
Texte,
in
erster
Linie
aber die
'Penthesilea',
unter
neuropathologischen
Aspekten
gelesen;
und
schließlich
findet
sich im
Kapitel
»Kannibalisches«
seiner
unter
dem
Pseudonym
Linke
Poot
erschienenen
Essays
Der
deutsche
Maskenball
(1921)
eine
Würdigung
der
Penthesilea
als
Musterstück
der
Somatisierung
und
regressiven
Entsublimierung
von
Sprache
und
Bewusstsein:
"Ein
rasendes
und
außerordentliches
Stück
ist von
Kleist
die
>Penthesilea<.
Sie hat
ihm bei
Goethe
das
Genick
gebrochen,
aber ist
gräßlich
schön
geblieben.
Es ist
charakteristisch,
daß das
Stück,
das
lange
Zeit nur
ein
Leckerbissen
von
Literaten
war, von
einer
Volksbühne
bei
hervorragender
Regie
unter
großer
Ergriffenheit,
mächtiger
Spannung
und
Teilnahme
gegeben
werden
kann.
Die
erregte
Zeit
fordert
starke
Akzente,
der
starke
Akzent
schallt
an
aufgerissene
widerklingende
Seelen.
In
diesem
Stück
w7irft
sich die
Heldin
in einem
Verwirrtheits-
und
Dämmerzustand
über den
Liebsten
- in
einem
Mißverständnis,
das so
sehr
Mißverständnis
ist, daß
sie
selbst
von
einer
Silbenverwechslung,
Küssen
und
Bissen,
von
einem
reimerischen
Irrtum
spricht
-, und
küßt ihn
mit den
Zähnen
und
Händen
in
Stücke,
um
nachher
bluttriefend
zur
Besinnung
zu
kommen.
[...]
Aber
dies ist
nur ein
Mittel
zum
Zweck;
worauf
es
ankommt,
Kleist
wie uns:
es muß
einer
gefressen
werden,
bildlich,
und was
hier so
sensationell
ist,
auch
unbildlich.
Das ist
in allen
Tragödien
so, und
hier
läßt es
sich mit
Händen
greifen.
Ein
Schlachtopfer,
das wir
brauchen.
Tragödie
hat
seinen
Namen
vom
Böcklein,
das
einstmals
geopfert
wurde;
das
Böcklein
ist
veschwunden;
wir
halten
uns an
den
Menschen!
Denn wir
sind
Kannibalen
und
brechen
täglich
die
irdische
Speiseordnung;
wir
füttern
uns im
Theater
satt."
(Nachruhm
Nr.
623ab) |
|

“O es gibt kein
Wesen in der
Welt, das ich so
ehre wie meine
Schwester. Aber
welchen
Missgriff hat
die Natur
begangen, als
sie ein Wesen
bildete, das
weder Mann noch
Weib ist,
gleichsam wie
eine Amphibie
zwischen zwei
Gattungen
schwankt.“
Sie war eine
Männin, die ihr
Geschlecht
'vergessen’
hatte.
Ulrikens
Charakter hatte
Kleist die erste
Idee zur
’Penthesilea’
eingegeben.
(Kurt Hofoff)
|
"Von
glühendem,
krankhaftem
Ehrgeiz beseelt
und tief gebeugt
wegen der
Nichtanerkennung
seiner
Dichtungen. Litt
an chronischer
Schwermut und
ungeheuerlicher
Maßlosigkeit in
allen Dingen.
Unbändiger
Wandertrieb und
absolutes
Unvermögen, ein
Amt zu
übernehmen.
Unbeständigkeit
in der Liebe."
Und weiter:
"Fiel selbst bei
Geringfügigkeiten
der Exaltation
anheim. Onanie
mit
Selbstvorwürfen.
Schüchtern,
stotterte,
verlegen,
errötete. Voll
Geheimniskrämerei.
Bot oft den
Freunden an,
gemeinsam zu
sterben.
Oft
sehr zerstreut.
Führte murmelnde
Selbstgespräche.
Sehr seltsam,
bizarr.
Unbewußt
homosexuell.
Nach Sadger war
er bisexuell."
"Zu Kleists
Schwester Ulrike
gibt es in der
Akte nur einen
Personalbogen,
der aber zu
keinem eigenen
Gutachten mehr
ausformuliert
wurde. Als
"homosexuell"
und herrisch
wird Kleists
Vertraute da
gekennzeichnet;
er habe zu ihr
ein Verhältnis
unterhalten, in
dem auch
"sadistisch-masochistische
Züge" zu
unterscheiden
gewesen seien."
(Sascha Feustel)
|
Immer
wieder ist in
der
Forschung
in Bezug auf
Ulrike von
Kleist von der 'pyladischen
Schwester' zu
lesen, die
Johann Georg
Scheffner, ein
Militärbeamter
aus dem
Königsberger
Bekanntenkreis
der Geschwister
anfänglich
verwandte.
Ulrike 'pyladisch
gesinnte kluge
Schwester' war
die richtige
Ergänzung zum
feminin
veranlagten
Bruder Heinrich.
Pylades habe
Orest in keiner
Gefahr
verlassen, dass
er sogar für ihn
zu sterben
bereit war,
weshalb er sich
als Orest
ausgab, als dem
die Sühne für
seinen
Muttermord
drohte.
Ulrike mangelte
es also, um die
Anerkennung
seitens des
Bruders zu
erhalten nicht
an die Fähigkeit
zur Aufopferung
- die bewies sie
immer wieder -
aber es mangelte
ihr am
männlichen
Geschlecht. Als
sie sich dann
als Mann zeigte,
konnte er ihre
Unterstützung
annehmen.
Kleist
benutzte für
sein Konzept der
'Penthesilea' das
Standardwerk der
damaligen Zeit,
das 'Gründliche
Mythologische
Lexikon' von
Benjamin
Hederich, worin
auch vermerkt
ist: "dass Pylades als ein
Exempel eines
wahrhaft treuen
Freundes in dem
Alterthume
gepriesen wird."
Die 'weibliche
Heldenseele'
Ulrike ist
ebenso ein
Produkt seiner
Phantasie und
seines Begehrens
wie 'Penthesila',
weshalb die
beiden sich auch
so schön
miteinander
vergleichen
lassen. Dem Bild
der Amazone
nähert sich das
der 'pyladischen
Schwester',
ähnlich der
mythologischen
Jungfrau, der
starken,
selbstständigen
Frau, nicht
gebunden an eine
Mann und nicht
hingegeben einem
Mann, dafür
selbst mit
männlichen
Attributen
ausgestattet.
(Sigrid Weigl)
|
War nach dem
Mythos Achilles
der Mörder
'Penthesileas',
nutzte Kleist
ein Variant, der
ebenfalls im
'Gründlichen
mythologischen
Lexikon' (Seite
52, Kapitel II)
erwähnt ist.
Danach habe
Penthesilea "den
Achilles zuerst
selbst erleget"
sei aber später
von Achilles,
der von seiner
Mutter wieder
zum Leben
erweckt worden
sei, getötet
worden.
Hederich nennt
in seinem
Lexikon 'Ptolomäus
Chennus', den
griechischen
Schriftsteller
des 1.
Jahrhunderts, als Quelle.
Als Kleist und
Ulrike in Weimar
Station machten
- ob sie dort
tatsächlich
Goethe und
Schiller sahen,
ist nicht zu
erforschen -
trafen sie
Christoph Martin
Wieland, dem
nicht klar war,
dass er in der
zweiten Person
in
Männerkleidern die Schwester
des Besuchers
vor sich hatte.
Er fragt sie,
kannst Du Dich
dem allgemeinen
Schicksal Deines
Geschlechts
entziehen, das
nun einmal
seiner Natur
nach die zweite
Stelle in der
Reihe der Wesen
bekleidet? Nicht
einen Zaun,
nicht einen
elenden Graben
kannst Du ohne
Hülfe eines
Mannes
überschreiten.
Sie nimmt die
Unweiblichkeit
auf sich,
kleidet sich
männlich streng,
was nach ihrer
Meinung viel
bequemer ist als
die Mode der
Damen
mitzumachen.
Über diese
Maske, mit der
die Schwester
optisch belegt
war und dem
Wunsch, dass die
aufopferungsbereite
Person ein Mann
zu sein hatte,
formte sich
Kleist die
Amazone
'Penthesilea'.
Maßgeblich für
diese
Dramaturgische
Ausformung der
Rolle war auch seine Neigung
zum eigenen
Geschlecht.
Am 7. Januar
1805 schreibt er
an Herrn
Ernst
von
Pfuel,
ehemals
Lieutenant
im
Regiment
Sr.
Majestät
des
Königs,
Hochwohlgeb.
zu
Potsdam.
Du übst,
du
guter,
lieber
Junge,
mit
Deiner
Beredsamkeit
eine
wunderliche
Gewalt
über
mein
Herz
aus, und
ob ich
Dir
gleich
die
ganze
Einsicht
in
meinen
Zustand
selber
gegeben
habe, so
rückst
Du mir
doch
zuweilen
mein
Bild so
nahe vor
die
Seele,
daß ich
darüber,
wie vor
der
neuesten
Erscheinung
von der
Welt,
zusammenfahre.
Ich
werde
jener
feierlichen
Nacht
niemals
vergessen,
da Du
mich in
dem
schlechtesten
Loche
von
Frankreich
auf eine
wahrhaft
erhabene
Art,
beinahe
wie der
Erzengel
seinen
gefallnen
Bruder
in der
Messiade,
ausgescholten
hast.
Warum
kann ich
Dich
nicht
mehr als
meinen
Meister
verehren,
o Du,
den ich
immer
noch
über
alles
liebe?
Wie
flogen
wir vor
einem
Jahre
einander,
in
Dresden,
in die
Arme!
Wie
öffnete
sich die
Welt
unermeßlich,
gleich
einer
Rennbahn,
vor
unsern
in der
Begierde
des
Wettkampfs
erzitternden
Gemütern!
Und nun
liegen
wir,
übereinander
gestürzt,
mit
unsern
Blicken
den Lauf
zum
Ziele
vollendend,
das uns
nie so
glänzend
erschien,
als
jetzt,
im
Staube
unsres
Sturzes
eingehüllt!
Mein,
m e i n
ist
die
Schuld,
ich habe
Dich
verwickelt,
ach, ich
kann Dir
dies
nicht so
sagen,
wie ich
es
empfinde.
-
Was soll
ich,
liebster
Pfuël,
mit
allen
diesen
Tränen
anfangen?
Ich
möchte
mir, zum
Zeitvertreib,
wie
jener
nackte
König
Richard,
mit
ihrem
minutenweisen
Falle
eine
Gruft
aushöhlen,
mich und
Dich und
unsern
unendlichen
Schmerz
darin zu
versenken.
So
umarmen
wir uns
nicht
wieder!
So
nicht,
wenn wir
einst,
von
unserm
Sturze
erholt,
denn
wovon
heilte
der
Mensch
nicht!
einander,
auf
Krücken,
wieder
begegnen.
Damals
liebten
wir
ineinander
das
Höchste
in der
Menschheit;
denn wir
liebten
die
ganze
Ausbildung
unsrer
Naturen,
ach! in
ein paar
glücklichen
Anlagen,
die sich
eben
entwickelten.
Wir
empfanden,
ich
wenigstens,
den
lieblichen
Enthusiasmus
der
Freundschaft!
Du
stelltest
das
Zeitalter
der
Griechen
in
meinem
Herzen
wieder
her, ich
hätte
bei Dir
schlafen
können,
Du
lieber
Junge;
so
umarmte
Dich
meine
ganze
Seele!
Ich habe
Deinen
schönen
Leib
oft,
wenn Du
in Thun
vor
meinen
Augen in
den See
stiegest,
mit
wahrhaft
mädchenhaften
Gefühlen
betrachtet.
Er
könnte
wirklich
einem
Künstler
zur
Studie
dienen.
Ich
hätte,
wenn ich
einer
gewesen
wäre,
vielleicht
die Idee
eines
Gottes
durch
ihn
empfangen.
Dein
kleiner,
krauser
Kopf,
einem
feisten
Halse
aufgesetzt,
zwei
breite
Schultern,
ein
nerviger
Leib,
das
Ganze
ein
musterhaftes
Bild der
Stärke,
als ob
Du dem
schönsten
jungen
Stier,
der
jemals
dem Zeus
geblutet,
nachgebildet
wärest.
Mir ist
die
ganze
Gesetzgebung
des
Lykurgus,
und sein
Begriff
von der
Liebe
der
Jünglinge,
durch
die
Empfindung,
die Du
mir
geweckt
hast,
klar
geworden.
Komm zu
mir!
Höre,
ich will
Dir was
sagen.
Ich habe
mir
diesen
Altenstein
lieb
gewonnen,
mir sind
die
Abfassung
einiger
Reskripte
übertragen
worden,
ich
zweifle
nicht
mehr,
daß ich
die
ganze
Probe,
nach
jeder
vernünftigen
Erwartung
bestehen
werde.
Ich kann
ein
Differentiale
finden,
und
einen
Vers
machen;
sind das
nicht
die
beiden
Enden
der
menschlichen
Fähigkeit?
Man wird
mich
gewiß,
und
bald,
und mit
Gehalt
anstellen,
geh mit
mir nach
Anspach,
und laß
uns der
süßen
Freundschaft
genießen.
Laß mich
mit
allen
diesen
Kämpfen
etwas
erworben
haben,
das mir
das
Leben
wenigstens
erträglich
macht.
Du hast
in
Leipzig
mit mir
geteilt,
oder
hast es
doch
gewollt,
welches
gleichviel
ist;
nimm von
mir ein
Gleiches
an! Ich
heirate
niemals,
sei Du
die Frau
mir, die
Kinder,
und die
Enkel!
Geh
nicht
weiter
auf dem
Wege,
den du
betreten
hast.
Wirf
Dich dem
Schicksal
nicht
unter
die
Füße,
es ist
ungroßmütig,
und
zertritt
Dich.
Laß es
an einem
Opfer
genug
sein.
Erhalte
Dir die
Ruinen
Deiner
Seele,
sie
sollen
uns ewig
mit Lust
an die
romantische
Zeit
unsres
Lebens
erinnern.
Und wenn
Dich
einst
ein
guter
Krieg
ins
Schlachtfeld
ruft,
Deiner
Heimat,
so geh,
man wird
Deinen
Wert
empfinden,
wenn die
Not
drängt.
-
Nimm
meinen
Vorschlag
an. Wenn
Du dies
nicht
tust, so
fühl
ich, daß
mich
niemand
auf der
Welt
liebt.
Ich
möchte
Dir noch
mehr
sagen,
aber es
taugt
nicht
für das
Briefformat.
Adieu.
Mündlich
ein
mehreres.
Berlin,
den 7.
Januar
1805
Heinrich
v.
Kleist.
|
Am 18. März 1799
geht ein Brief
an seinen
ehemaligen
Lehrer Martini.
Ja,
Lieber!
Nicht
Schwärmerei,
nicht
kindische
Zuversicht
ist
diese
Äußerung.
Erinnern
Sie
sich,
daß ich
es für
meine
Pflicht
halte,
diesen
Schritt
zu tun;
und ein
Zufall,
außerwesentliche
Umstände
können
und
sollen
die
Erfüllung
meiner
Pflicht
nicht
hindern,
einen
Entschluß
nicht
zerstören,
den die
höhere
Vernunft
erzeugte,
ein
Glück
nicht
erschüttern,
das sich
nur im
Innern
gründet.
In
dieser
Überzeugung
darf ich
gestehen,
daß ich
mit
einiger,
ja
großer
Gewißheit
einer
fröhlichen
und
glücklichen
Zukunft
entgegensehe.
In mir
und
durch
mich
vergnügt,
o, mein
Freund!
wo kann
der
Blitz
des
Schicksals
mich
Glücklichen
treffen,
wenn ich
es fest
im
Innersten
meiner
Seele
bewahre?
Immer
mehr
erwärmt
und
begünstigt
mein
Herz den
Entschluß,
den ich
nun um
keinen
Preis
der
Könige
mehr
aufgeben
möchte,
und
meine
Vernunft
bekräftigt,
was mein
Herz
sagt,
und
krönt es
mit der
Wahrheit,
daß es
wenigstens
weise
und
ratsam
sei, in
dieser
wandelbaren
Zeit so
wenig
wie
möglich
an die
Ordnung
der
Dinge zu
knüpfen.
Diese
getreue
Darstellung
meines
ganzen
Wesens,
das
volle
unbegrenzte
Vertrauen,
dessen
Gefühle
mir
selbst
frohe
Genüsse
gewähren,
weil
eine
zufällige
Abgezogenheit
von den
Menschen
sie so
selten
macht,
wird
auch Sie
nicht
ungerührt
lassen,
soll und
wird mir
auch Ihr
Vertrauen
erwerben,
um das
ich im
eigentlichsten
Sinne
buhle.
Den
Funken
der
Teilnahme,
den ich
bei der
ersten
Eröffnung
meines
Plans in
Ihren
Augen
entdeckte,
zur
Flamme
zu
erheben,
ist mein
Wunsch
und
meine
Hoffnung.
Sein Sie
mein
Freund
im
deutschen
Sinne
des
Worts,
so wie
Sie
einst
mein
Lehrer
waren,
jedoch
für
länger,
für
immer.
|
|

Der
Penthesilea-Mythos
stammt -
schriftlich
festgehalten in
einer
nachhomerischen
Dichtung aus dem
7. Jahrhundert
vor der
Zeitenwende -
aus nicht
bekannter
Vergangenheit.
Herodot, Prokop,
Dictys Cretensis
oder Quintus
Smyrna wie auch
Diodor
berichten.
Um 1200 ist der
trojanische
Krieg fast
entschieden,
Achill hat
Hektor getötet,
die Trojaner
ohne Anführer
mutlos.
Ein Trupp Frauen
stürmt auf
ungebändigten
Pferden daher
und wirft sich -
angeführt von
ihrer Königin in
die Schlacht.
Schwere Waffen
der Frauen
treffen:
Brustharnische,
Lanzen, Helme,
Schilde - das
Blut fließt,
Penthesilea mit
unbeirrtem
Kampfesmut
stürzt sich mit
ihren Frauen auf
die Griechen.
Die Amazonen
führten
waffenstarrend
die Kriege,
eroberten für
ihre Familien,
die von den
daheimgebliebenen
Männern versorgt
wurden.
Waren sonst die
Frauen
Griechenland,
rechtlos,
sprachlos, von
allen Ämtern und
öffentlichen
Veranstaltungen
ausgeschlossen,
stürzten sich
hier Frauen auf
sie und
metzelten sie
ab.
Die patriarchale
Ordnung geriet
ins Wanken.
Nicht nur, dass
ein Schwert
gegen die Männer
geführt wird,
Frauen führen
ihre Schwerter
und Streitäxte
gegen sie.
Der Mann war die
zentrale Gewalt
in einem Haus,
eine Frau hatte
den Haushalt zu
führen, Kinder
zu bekommen und
zu erziehen, der
Mann hatte für
sich seine
Freunde und
männliche
Geliebte.
Eine Frau, dem
Hause vorstehend
musste
untergehen, mit
schweren Waffen
in Kriegen
kämpfende Frauen
konnten nur
durch
Überraschungsangriffe
siegen,
langanhaltende
Kämpfe gingen
über ihre
Kräfte.
Untersuchungen
im Bereich der
nördlichen
Schwarzmeerküste
zeigen Gräber
von Frauen, die
mit Waffen
beigesetzt
wurden - Pfeile,
Köcher, Bogen
und Lanzen,
Kampfgürtel.
|

|
Und drinnen
waltet
Die zuechtige
Hausfrau,
Die Mutter der
Kinder,
Und herrschet
weise
Im haeuslichen
Kreise,
Und lehret die
Maedchen
Und wehret den
Knaben,
Und reget ohn'
Ende
Die fleissigen
Haende,
Und mehrt den
Gewinn
Mit ordnendem
Sinn,
Und fuellet mit
Schaetzen die
duftenden Laden,
Und dreht um die
schnurrende
Spindel den
Faden,
Und sammelt im
reinlich
geglaetteten
Schrein
Die schimmernde
Wolle, den
schneeigen Lein,
Und fueget zum
Guten den Glanz
und den
Schimmer,
Und ruhet
nimmer.
Hatte Schiller
im Musenalmansch
auf das Jahr
1800 sich noch
mit diesen
Versen über die
züchtige
Hausfrau im
’Lied von der
Glocke’
ausgelassen -
über die sich
Karoline
Schlegel
ausschütten
wollte vor
Lachen
-
setzte wenig
später - im
realen Leben und
in der Literatur
zu beobachten -
die
Diskriminierung
der Frau ein.
Man sprach ihr
politisches
Denken ab,
alleinstehend
und
intellektuell
wurde
gleichgestellt
mit
Unweiblichkeit.
So stand
Schillers
'Johanna' am
Ende einer
emanzipatorischen
Entwicklung,
‘Unterdrückung’
der Frau folgte,
die Feststellung
der Gleichheit
der Geschlechter
war aufgehoben.
Misst man aber
die Kultur eines
Volkes an
Friedlichkeit,
Abscheu gegen
Grausamkeit und
Kommunikationsfähigkeit,
so sind die
Frauen das
zivilisierte
Geschlecht,
Nietzsche meint
zwar, dies seien
die Tugenden der
Schwächeren, so
sind diese eben
die Kulturträger
eine
zivilisierten
Menschheit.
War vor dem 18.
Jahrhundert die
Frau als Aktive
auch im
sexuellen
erfasst worden,
wurde sie danach
einerseits zur
tugendhaften
Gattin reduziert
und auf der
anderen Seite
als Hetäre
festgelegt. Das
gesamte 19.
Jahrhundert war
erfüllt von den
Herabbsetzungsunternehmungen,
Der
dreiundzwanzigjährige
Weinberger
setzte 1903 dem
Ganzen die Krone
auf, mit seinen
frauenfeindlichen
Aussagen in:
‘Geschlecht und
Charakter’.
Doch auch im 19.
Jahrhundert gab
es Beispiele der
Emanzipation der
Frau in
Lebensführung,
dokumentiert in
der Literatur.
Die Frauen der
deutschen
Romantiker:
Dorothea
Mendelssohn-Schlegel,
Karoline
Schlegel-Schilling,
Madame de Staël,
George Sand.
Schillers Hass
gegen Karoline
Schlegel, mit
der Titulierung
als ‘Madame
Luzifer’ und die
Polizeiaktionen
Napoleons gegen
die Staël, die
antisemitischen
Attacken gegen
die Tochter
Moses
Mendelssohns,
der erotische
Skandal, den
George Sand
erlebte.
Heinrich von
Kleist sieht
seine Schwester
Ulrike
nicht
entsprechend den
zeitgenössischen
Weiblichkeitsmustern:
Pflichten als
Gattin und
Mutter, damit
Unselbständigkeit,
verschönt durch
das Lob der
Weiblichkeit -
er nimmt ihr
herbes,
männliches Wesen
für sich in
Anspruch: Reisen
und
Selbstständigkeit.
Selbstständigkeit
als
Liebesverzicht:
Nie wollte
Ulrike sich in
einer Ehe binden
und sie
tat es auch
nicht, sondern
sie strickte ihm
für seine
Behaglichkeit
lieber eine
Weste.
Eschborn, den
25. Febr. 1795
Liebe Ullrique,
Ein Geschenk mit
so
außerordentlichen
Aufopferungen
von Seiten der
Geberin
verknüpft, als
Deine für mich
gestrickte
Weste, macht
natürlich auf
das Herz des
Empfängers einen
außerordentlichen
Eindruck. Du
schlägst jede
Schlittenfahrt,
jede Maskerade,
jeden Ball, jede
Komödie aus, um,
wie Du sagst,
Zeit zu
gewinnen, für
Deinen Bruder zu
arbeiten;
Du zwingst Dir
eine
Gleichgültigkeit
gegen die für
Dich sonst so
reizbaren
Freuden der
Stadt ab, um Dir
das einfachere
Vergnügen zu
gewähren, Deinen
Bruder Dich zu
verbinden.
Erlaube mir daß
ich hierin sehr
viel finde;
mehr, - als
gewöhnlich
dergleichen
Geschenke an
wahren inneren
Wert in sich
enthalten.
Gewöhnlich denkt
sich der Geber
so wenig bei der
Gabe, als der
Empfänger bei
dem Danke;
gewöhnlich
vernichtet die
Art zu geben,
was die Gabe
selbst
vielleicht gut
gemacht haben
würde. Aber Dein
Geschenk heischt
einen ganz
eignen Dank.
Irre ich nicht,
so hältst Du den
Dank für
überflüssig, für
gleichgültig,
oder eigentlich
für
geschmacklos.
Kleist -
Sämtliche
Briefe -
1963 -
S. 1119 |
Später war sie
mit ihrem Bruder
auf Reisen,
übernahm die
Organisation,
hatte das Geld
parat und: "Wo
ein anderer
überlegt, da
entschließt sie
sich, und wo er
spricht, da
handelt sie" -
stellt Kleist in
einem Brief von
der Paris-Reise
im Jahr 1801
fest.
Als er im Jahr
1807 in
französische
Kriegsgefangenschaft
gerät, reiste
sie nach Berlin,
geht zu den
französischen
Behörden und zu
General Clark
und ruht "nicht
eher bis ich
Heinrich frei
gesprochen
weiß."
|

Schiller -
Johanna von
Orleans
Kleist -
Penthesilea
Hebbel - Judith
die Reihenfolge
zeigt sich in
der Literatur
der ‘Frau mit
der Waffe’.
Schiller hatte
seiner 'Johanna'
über eine
Traumgestalt die
Möglichkeit
gegeben, eine
militärische
Mission - unter
der Aufgabe
ihrer
Weiblichkeit:
sie hatte
Keuschheit
gelobt - zu
erfüllen, die
auf einer
politischen
Einschätzung
beruhte.
Am Rande
Lothringens
ein Dorf
- Sommer
1425 -
ein
Mädchen,
13 Jahre
alt,
hört
Stimmen,
die sie
auffordern,
dem
König zu
Hilfe zu
eilen.
Als
gottgewollt
sieht
Jeanne
ihren
Auftrag,
den sie
mit
einer
Erscheinung
von
Michael,
dem
Erzengel,
erhält,
Frankreich
zu einen
und das
Land von
den
Engländern
zu
befreien.
Es werde
keine
Rettung
zu
geben,
außer
durch
sie.
Männerkleidung
und
Kurzhaarschnitt
werden
ihr
äußeres
Zeichen
für
Macht
und
Führerschaft.
Sie
steht
Karl
VII,
einem
Herrscher
ohne
Krone,
ohne
Geld und
ohne
Macht,
nicht in
den für
Frauen
üblichen
langen
Kleidern,
sondern
entgegen
der
Regel
wie ein
männlicher
Kämpfer
gegenüber
und
legitimiert
sich
durch
eine
Zeichen
als die
von
allen
erwartete
Jungfrau.
Karl
glaubt
Jeanne,
sie
allein
werde
Frankreich
befreien,
lässt
eine
Überprüfung
ihrer
Jungfernschaft
durchführen
-
Reinheit
und
Unversehrtheit
werden
dem
Mädchen
attestiert.
Die
Kirche
prüft
ihren
Glauben
und der
König
kann sie
nach
bestandener
Prüfung
als
'Kriegerin
Gottes'
in die
Schlacht
zu
schicken.
In
königlichem
Auftrag
wird ein
Heer für
sie
zusammengestellt,
eine
Rüstung
aus
Weißmetall
für sie
hergestellt,
18 bis
20
Kilogramm
schwer.
Sie sei
vom
König
des
Himmels,
von Gott
selbst
gesandt
und in
seinem
Auftrag
führe
sie
selber
das
Schwert
und die
Krieger
in die
Schlacht.
|
Hebbel nahm den
Gedanken für
seine jüdische
Jungfrau 'Judith'
40 Jahre später
in Anspruch, die
Hebräer und die
ganze Region von
einem Tyrannen
zu befreien, der
als Heerführer
des Nebukadnezar
in den Nahen
Osten
eingedrungen
war, Kleist sah
1808 seine
'Penthesilea' als waffentragende
Amazone in den
Trojanischen
Krieg
verstrickt.
Zwischen 'Johanna'
und 'Penthesilea'
liegen nur die
Jahre von 1801
bis 1808, sie
enthielten aber
auch 'Frau
Leonore' mit der
Waffe, die vor
'Pizarro' nicht
zurückschreckt.
Wagners 'Ortrud'
trug 1845 kein
Schwert, hatte
sie aber eine
politische Waffe
‘zur Hand’, die
Intrige, die
Lüge, mit der
sie sich
durchzusetzen
bemühte, wie
schon Schillers
'Eboli', 'Terzky',
'Isabella', 'Milford' - die
'Eglantine' der
Chesy und die
'Orsina' wie auch
die 'Marwood'
Lessings.
'Penthesilea' ist Kleist’s Frau
mit der Waffe,
nicht nur sie,
auch ein Heer
von Amazonen
folgt ihr
bewaffnet, sich
Männer zu
fangen, die für
den
Weiterbestand
der
Frauenvolksmacht
sorgen sollen.
|

Kleist griff
den Kampf der
Geschlechter in
seiner
'Penthesilea'
auf - es sind
nicht die
Griechen und die
Trojaner im
Kampf
gegeneinander,
sondern Frau
gegen Mann.
Strindberg,
Ibsen folgten
mit Texten. Die Unterwerfung des
jeweilig anderen
ist Gebot.
Hier darf die
Frau sich nur
mit einem Mann
vereinigen, wenn
sie ihn vorher
besiegt hat.
Problematisch,
wenn Liebe ins
Spiel kommt -
und hier setzt
Kleist an.
Penthesilea
verliebt sich in
Achill - will
aber die Gesetze
des
Amazonenstaates
nicht brechen.
Sie kämpfen,
Penthesilea
glaubt nach
einer Ohnmacht,
Achill besiegt
zu haben und
heimführen zu
können, doch der
spielte nur den
Gefangenen.
Als Penthesilea
die Täuschung
aufdeckt, tötet
sie Achill,
rasend vor Wut
über die
Schmach, von
einem Mann
betrogen worden
zu sein.
Kleist sandte
das Werk in
tiefer Ehrfurcht
an Goethe.
Dieser aber auf
Maß, Gesetz und
schöpferischen
Ausgleich von
Ich und Welt
gerichtet,
musste sich
durch die
Kleist'sche
Verherrlichung
des zum
Untergang
bestimmten
Unbedingten und
Elementaren
unvermeidlich zu
Widerstand und
Ablehnung
aufgerufen
fühlen.
Zudem eine
Ungeheuerlichkeit,
dieses Thema der
bestimmenden und
im Kampf
obsiegenden Frau
in der damaligen
Zeit - weit weg
von
Emanzipationsbemühungen
- für das
Theater zu
bearbeiten und
dem Publikum des
ausgehenden 18.
Jahrhunderts zu
präsentieren.
Goethe, dem
Kleist das Stück
zusandte, lehnte
ab, da die
Penthesilea sich
in so fremder
Region beweg,
dass er sich in
diese erst
finden müsse:
Ew. Hochwohlgebornen bin ich sehr dankbar für das
übersendete
Stück
des
Phöbus.
Die
prosaischen
Aufsätze,
wovon
mir
einige
bekannt
waren,
haben
mir viel
Vergnügen
gemacht.
Mit der
Penthesilea
kann ich
mich
noch
nicht
befreunden.
Sie ist
aus
einem so
wunderbaren
Geschlecht
und
bewegt
sich in
einer so
fremden
Region
daß ich
mir Zeit
nehmen
muß mich
in beide
zu
finden.
Auch
erlauben
Sie mir
zu sagen
(denn
wenn man
nicht
aufrichtig
sein
sollte,
so wäre
es
besser,
man
schwiege
gar),
daß es
mich
immer
betrübt
und
bekümmert,
wenn ich
junge
Männer
von
Geist
und
Talent
sehe,
die auf
ein
Theater
warten,
welches
da
kommen
soll.
Ein Jude
der auf
den
Messias,
ein
Christ
der aufs
neue
Jerusalem,
und ein
Portugiese
der auf
den Don
Sebastian
wartet,
machen
mir kein
größeres
Mißbehagen.
Vor
jedem
Brettergerüste
möchte
ich dem
wahrhaft
theatralischen
Genie
sagen:
hic
Rhodus,
hic
salta!
Auf
jedem
Jahrmarkt
getraue
ich mir,
auf
Bohlen
über
Fässer
geschichtet,
mit
Calderons
Stücken,
mutatis
mutandis,
der
gebildeten
und
ungebildeten
Masse
das
höchste
Vergnügen
zu
machen.
Verzeihen
Sie mir
mein
Geradezu:
es zeugt
von
meinem
aufrichtigen
Wohlwollen.
Dergleichen
Dinge
lassen
sich
freilich
mit
freundlichern
Tournüren
und
gefälliger
sagen.
Ich bin
jetzt
schon
zufrieden,
wenn ich
nur
etwas
vom
Herzen
habe.
Nächstens
mehr.
Weimar,
den 1.
Februar
1808
Goethe.
Kleist -
Sämtliche
Briefe -
1963 -
S. 1148
|
Erst 1876 wurde
'Penthesilea'
mit Clara
Ziegler in der
Titelrolle in
Berlin
uraufgeführt
und
nach vier
Vorstellungen
abgesetzt.
|

"Auf den ersten
Blick scheint
diese
verschollene
Geschichte mit
ihren Varianten
nicht besonders
reizvoll,
eigentlich
nichts als ein
Hin- und
Hergerede über
eine halb und
halb
gegenstandslose,
wilde und
blutige
Rauferei.
Aber eben das
Ungenaue der
Nachrichten und
ihre barbarische
Indifferenz
machten den
Stoff so
reizvoll für
Kleist. Es war
gerade seine,
diese tief im
Atavistischen
verwurzelte
Phantasie, derer
er bedurfte, das
Widersprüchliche
der alten
Überlieferung in
eines zu denken
und etwas
Einzigartiges
draus zu
machen."
(Joachim Maass -
Kleist - 1977,
S. 147)
|
|

|
Die
Schwarzen |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Inszenierung |
Petra
Wüllenweber |
|
|
|
Bühnenbild
/
Kostüme |
Susanne
Ellinghaus |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Die
Personen
und ihre
Darsteller
der am
29.09.2007
besuchten Vorstellunng |
|
|
| |
|
|
|
|
Penthesilea,
Königin
der
Amazonen |
Silke
Heise |
|
|
|
Prothoe,
Fürstin
der
Amazonen |
Silvia
Rhode |
|
|
|
Meroe,
Fürstin
der
Amazonen |
Nikola
Norgauer |
|
|
|
Asteria,
Fürstin
der
Amazonen |
Anna
Dörnte |
|
|
|
Die
Oberpriesterin
der
Diana |
Doris
Dubiel |
|
|
|
Hauptmännin |
Esther
Kuhn |
|
|
|
Achilles,
König
des
Griechenvolkes |
Michael
Haake |
|
|
|
Odysseus,
König
des
Griechenvolkes |
Paul
Kaiser |
|
|
|
Diomedes,
König
des
Griechenvolkes |
Stefan
Bräuler |
|
|
|
Antilochus,
König
des
Griechenvolkes |
Michael
Heuberger |
|
|
|
Hauptmann
/ Herold |
Florian
Münzer |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Mit tiefem
Seufzer
bemerkte,
anlässlich des
Einführungsvortrages
zu ’Penthesilea’
am 23.9.2007,
die Chefdramaturgin
des Theaters
Regensburg,
Friederike
Bernau, Heinrich
von Kleist sei
ein großer
deutscher Autor
– für den sie –
wie die
allermeisten
ihrer Theater-Kollegen,
die sie kenne,
große Verehrung
für ihn und für
sein Werk habe,
ein Autor an dem
man sich immer
reiben könne,
ein immer
Sperriger mit
großen
Gedankenbildern
mit einer
phantastischen
Sprache und es
sei egal, an
welchem Stück
man arbeite
“auch in welchem
Genre seiner
Stücke“, ein
großes Geschenk,
sich an ihm
reiben zu
dürfen.
Kleist habe aus
Familientradition
zunächst beim
Potsdamer
Garderegiment
gedient und auch
als junger
Mensch die
Belagerung von
Mainz
mitgemacht, sich
aber innerlich
nicht zu seiner
Tätigkeit als
Soldat bekennen
können. Er habe
immer Bedenken
gehabt, sich in
kriegerische
Auseinandersetzungen
zu begeben.
Mit 21 Jahren
habe er als
Leutnant seinen
Abschied
genommen, um
sich dann mit
Wissenschaften
zu beschäftigen,
“was seinem
Inneren viel
näher kam, was
ihm viel gemäßer
war.“
Er habe Mathematik,
Physik,
Philosophie
studiert “und
hat sich mit der
literarischen
Enzyklopädie
beschäftigt.“
Er sei ein immer
zerrissener
Mensch, ein
immer suchender
Mensch gewesen,
“der immer die
Gegenpole des
Lebens und in
seinem Wesen
gespürt hat“,
versucht habe,
sich in Regeln
wiederzufinden,
“bis die Regeln
sich erwiesen
als dem Leben
nicht
entsprechend.“
Dies spiegle
sich in seinem
Werk, in allen
Figuren, in
allen
Grundthemen
wieder. Auch die
Suche nach
Gerechtigkeit
sein ein großes
Stichwort für
sein
künstlerisches
Schaffen, die
suche nach
Wahrheit, wie
könne die
Wahrheit sein,
wie solle man
damit umgehen.
Der Wunsch
unabhängiger
Dichter zu sein,
Ruhe und Erdung
zu finden, zum
Beispiel als
Bauer,
bestimmten sein
Leben – die
Erfolge auch als
Verleger einer
Kunstzeitschrift
blieben
weitgehend aus,
die dramatischen
Werke hätten
seine
Zeitgenossen
eher befremdet
als begeistert.
Kleist selber habe
die
'Penthesilea' –
expressiv verbis
erwähnte Frau
Chefdramaturgin
auch den zerbrochnen
Krug - für
unaufführbar
gehalten.
Wahrscheinlich
hob sie ab, auf
den missglückten
Versuch einer
Inszenierung vom
zerbrochnen Krug
am Oberpfälzer
Metropoltheater
Regensburg in
der Spielzeit
2005/2006.
http://www.heerrufer.de/Kritik_Der_zerbrochne_Krug.htm
und
http://www.heerrufer.de/Kommentar_Kastrierter_Kleist.htm
Immer wieder sei
in den letzten
200 Jahren
versucht worden,
auch Kleist's
Werk 'Penthesilea'
aufzuführen, die
er 1806 begonnen
und 1807 fertiggestellt
habe.
Nach der
griechischen
Mythologie
versuchen
Penthesilea und
Achill, die sich
vor Troja nach
Kämpfen
begegnen, eine
Bezeigung
aufzubauen, was
fehlschlage, da
beide
verschiedenen
Regeln
unterworfen
seien und
Grundauffassungen
der Geschlechter
unterworfen
sind.
Die Amazonen mit
ihrer Königin
Penthesilea
bauten ihren
Frauenstaat ohne
Männer – müssen
den Mann, den
sie zur
Nachzucht wählen
im Kampf besiegt
haben und den
sie zu einem
Vereinigungsfest
“dann mit sich
nehmen. Dort
wird der
Nachwuchs der
Amazonen
gesichert“, die
Männer werden
aus dem reinen
Frauenstaat
entlassen, die
männlichen
Neugeborenen
werden getötet,
nur die
weiblichen
werden am Leben
erhalten.
Achill erfahre
von Penthesilea
deren
Lebensumstände,
er wolle sich
von ihr besiegen
lassen, er
fordere sie
heraus, “sie
missversteht
diese
Kampfansage
gänzlich und
tödlich, sie
fühlt sich von
ihm verraten und
sie rüstet hoch
auf, um gegen
ihn in den Krieg
zu ziehen, in
eine Schlacht,
auf die er
überhaupt nicht
eingerichtet,
auf die er nicht
vorbereitet ist
und auf heftige
Art und Weise
tötet sie ihn,
sie ist rasend,
sie ist
wahnsinnig und
kann, nachdem
die Tat
geschehen ist,
gar nicht
fassen, was da
geschehen ist,
noch viel
weniger, dass
sie Achill
getötet hat.“
Es gebe für sie
dann auch nur
noch die
Möglichkeit,
sich vom Gesetz
der Amazonen
freizumachen und
Achill in den
Tod zu folgen,
um so
möglicherweise
eine Verbindung
zu ihm zu
finden.
Mit dem Werk
'Penthesilea'
habe man einen
großen Stoff vor
sich, mit einer
gewaltigen
Sprache, ein
Werk, das man
sich bevor die
Proben begännen,
erst einmal
erschließen
müsse, “ein
Werk, das mit
sehr vielen
Synonymen für
Namen spielt, es
ist eine sehr
reiche Sprache
und natürlich
auch ein sehr
reiche
mythologische
Zuordnung.“
|

Als Regisseurin
– bemerkte Frau
Wüllenweber -
beschäftige sie sich
sehr gerne mit
Kleist, wenn
denn ein Theater
anrufe und
frage, ob man
die
’Penthesilea’
inszenieren
wolle, zumal
dieses Stück
eine maximale
Herausforderung
bedeute, auch
weil das Stück
sehr
ungewöhnlich
sei, “zum einen
vom Thema, dann
vom Aufbau,“ da
Kleist nicht den Fünf-Akter oder
was später
modern gewesen
sei, den
Dreiakter,
sondern eine
Folge von 24
Auftritten
wählte, wobei er
sich an die
Ilias anlehnte.
Es sei “viel
Größenwahn
dabei, aber
faszinierender
Größenwahn.“
Lange habe das
Stück als
unspielbar
gegolten.
Fälschlicherweise
behauptet die in
Regensburg
hauptsächlich
als
Kinderstück-Regisseurin
bekannte Frau
Wüllenweber, das
Stück sei erst
100 Jahre nach
Kleist’s Tod
gespielt worden.
Hier irrt die
Dame, denn - wie
bereits
hier beschrieben -
gab es 1876, das
sind also 65 und
nicht 100 Jahre nach
seinem Tod,
erste
Aufführungen.
Hier seien Frau Wüllenweber die
einschlägigen
Schauspielführer
oder das
Internet zur
vorherigen
Informationsnahme
empfohlen. (25.
4. 1876
Uraufführung der
"Penthesilea" am
"Neuen Theater"
in Berlin -
http://www.kleist.org/misc/gedenktage.htm)
Das Regietheater
der 70er und
80er Jahre habe
die Situation
verändert, es
seien spannende
'Penthesilea-Inszenierungen'
entstanden wie
in Hamburg und
in Bochum “und
das Tolle an dem
Stück is', dass
es nicht einen
Weg gibt wie man
dieses Stück
erzählt.“ Dies
sei gleichzeitig
auch ein Fluch,
das Stück habe
nichts
Zwingendes. Man
müsse sehr gut
suchen und
überlegen und
ausprobieren und
das sei
eigentlich das
Spannendste an
der Regiearbeit,
dass man nicht
sklavisch was
vom Textbuch
runter
inszeniert,
sondern zusammen
mit dem Ensemble
und auch schon
im Vorfeld mit
der
Bühnenbildnerin
sehr ausführlich
suche,
vorbereite,
aber auch bei
den Proben
eigentlich bis
zuletzt sehr,
sehr wach sein
müsse, um sich
zu entscheiden,
“arbeiten wir
hier lieber mit
einer Form,
arbeiten wir
hier lieber situativ
szenisch“ und
dadurch etwas
ganz Spezielles
entstehe.
Es gäbe auch
keine
'Penthesilea-Inszenierung',
die einer
anderen ähnele.
Viele Rollen
seien im
Personenverzeichnis
nicht
aufgeführt,
trotzdem komme
die Figur im
Text vor. So
entstehe die
Frage, welche
Rollen man
verwenden wolle
– sie habe sich
für
11 Figuren
entschieden, um
den Zwiespalt
zwischen
Individuum und
Gesellschaft
deutlich zu
machen. So könne
sie es nicht als
Solo zeigen wie
Edith Clever
seinerzeit,
sondern brauche
eine Gruppe von
Frauen, den
Amazonen-Staat,
den es nach
neuesten
Forschungen
tatsächlich
gegeben habe und
deren
Gegenspieler,
'die Männer'.
Die beiden
Welten, der
Krieg, der Kampf
seien nach
Meinung von Frau
Chefdramaturgin
nur die Folie
für ein
Seelendrama, für
die Begegnung
'Penthesilea' /
'Achill', wobei es
sehr um das
persönliche
Aufeinandertreffen
gehe, die “den
Kampf gewohnt
seien und von
der Liebe
überwältigt
werden.“
'Achill' und
'Penthesilea',
beide
Individuen,
versuchten aus
jeweils ihrem
System
auszubrechen.
Typisch für
Kleist sei, dass
er nicht nur ein
Thema in seinen
Stücken
abhandle,
sondern
verschiede
berühre, hier
auch ’die Liebe’
– zwei Menschen
wollten sich
kriegen, wie man
das sonst so
habe und
abgehandelt
werde, sondern
zwei Menschen
zeige,
'Penthesilea', die
zwar kämpfen,
aber nicht
küssen könne,
Achill, der
viele Frauen
gehabt habe,
aber einer
solchen Frau wie
’Penthesilea’
noch nie
begegnet sei,
die unabhängig
von ihren
Systemen
versuchten,
zueinander zu
kommen, hätten
auch in der
Mitte des
Stückes eine
ganz tolle
Passage, sie
versuchten sich
zu begreifen,
scheiterten aber
im Endeffekt an
dem, was sie
ausmache.
“Das ist das
gesellschaftliche
Außen und das
persönliche
Innen“ meinte
Frau
Chefdramaturgin
ergänzen zu
müssen, "sind
Themen, wie das
aufeinander
prallt" – es
seien die
einzelnen
Figuren und dazu
die große
Kampfanlage, die
grundsätzlich
vorhanden sei
und Frau
Regisseurin dazu
gebracht habe,
das Stück mit 11
Personen
anzulegen, um
Staatswesen zu
zeigen, auch um
deutlich zu
machen, dass
weder 'Achill'
noch 'Penthesilea'
sich
frei fühlten,
sich bewegten
und entscheiden
könnten, da sie
beide in ihr
jeweiliges
Staatswesen
verstrickt
seien.
Bei Kleist habe
jeder Darsteller
im Vorfeld die
Sprache
besonders zu
erproben und für
sich zu
erschließen,
damit sie beim
Beginn der
eigentlichen
Proben gut im
Mund liege. Frau
Heise habe, nach
eigenem
Bekunden, sich
stundenlang mit
der Sprache
beschäftigt und
den Text
gepaukt, wobei
man strukturell
vorgehen müsse,
bei Kleist
besonders über
die Syntax und
den Satzbau, die
Konstruktion,
die Architektur
eines Textes
sich erschließen
müsse, um ihn
dann
verinnerlicht zu
haben und
irgendwann, wenn
man ihn in sich
habe, dann sei
er
unverwechselbar
im Mund, dass
man ihn, dass er
gar nicht anders
klingen könne,
das
'Ihn-so-nahe-an-sich-ranzuziehen',
sei schon eine
Portion Arbeit,
das lese sich
nicht von
selber.
Wichtig auch,
dass auf den
eigentlichen
Text dann nicht
mehr der
Hauptaugenmerk
gerichtet sein
müsse, sondern
man den Text
könne, wobei es
eben hier auch
einen Unterschied
gebe, zum
’Text-Können’.
|
|

Man habe auch
mit einem
Bewegungschoreographen
gearbeitet, man
sei sehr froh,
dass er hier zu
dieser Arbeit an
der
'Penthesilea'
dazugekommen sei
- (Anmerkung:
für Geld tut
auch der gar
Manches).
“Was war denn
nun dein Ziel,
eure gemeinsame
Überlegung für
die kämpferische
Arbeit?“
Auf diese Frage
der
Chefdramaturgin
zum Thema
“kämpferische
Arbeit“ bemerkte
Frau
Regisseurin:
Wenn man dieses
Werk lese, das
sehr umfangreich
sei – im
Original 3400
Verse - frage
man sich, wie
man das umsetzen
solle.
Da ein großer
Bestanteil des
Werkes so
aufgebaut sei,
dass nicht alles
Geschehen auf
der Bühne selbst
dargestellt
werde, habe man
sich für eine
besondere
Interpretation
entschieden.
Vieles werde
sowohl
sprachlich aber
auch über Bilder
ausgedrückt, die
mit Bewegung
zusammenhingen.
Es gehe darum,
den Kampf am
Anfang auch
optisch zu
etablieren, er
sei hier nicht
'eine normale
Alltagssituation',
es sei nicht nur
ein äußerer,
sondern auch
einer inneren
Kampf, ein
Krieg, der noch
einmal
unterstützt
dargestellt
werden solle.
Man arbeite
einerseits mit
Eisenstangen,
die eine gewisse
Gewalt
demonstrierten,
die aber im
Laufe der
Inszenierung
niedergelegt
würden. Danach
werde es eine
andere Form von
körperlichem
Ausdruck geben.
Sie, die Frau
Regisseurin
meinte, da sie
ein
sprachübergreifendes
Arbeiten sehr
möge, da sie
aber nur vom
Schauspiel
komme, könne sie
den Darstellern
nicht
vermitteln, wie
die sich
'supertoll'
bewegen könnten,
so brauche sie
den ’Bastian’,
der vom Tanz
komme, schon
viel mit
Schauspielern
gearbeitet habe,
keine
Balletteinlagen
schaffe, sondern
Bewegungschoreographie
erarbeite.
Dies passe gut
zu dem Stichwort
’Rituale’ –
Haltungen, die
man einander
gegenüber
einnehme - warf
Frau
Chefdramaturgin
ein.
Nach Meinung von
Frau Regisseurin
sei das
Besondere an
dieser Sprache,
dass man sie
sowohl spreche,
dass sie jeder
verstehen könne,
dass man dazu
aber auch eine
Körpersprache
entwickeln
solle, die
dieses Stück
transportiere –
wichtig sei,
dass beide
Ausdrucksformen
miteinander
verschmölzen.
Das ’Sich
bekämpfen’ und
’Sich haben
wollen’
entwickle auch
eine gewissen
Erotik, das
’Macht-haben-wollen’
über den
anderen, was
eben nicht
unbedingt nur
Völker
gegeneinander,
sondern auch
Individuen, sich
gegenüberstehend,
einbeziehe.
Jeder der
beiden, ob
'Achill' oder
'Penthesilea',
habe letztlich
auch zu
kommunizieren,
um die eigene,
individuelle
Entscheidung,
den eigenen
’Mitstreitern’
zu vermitteln.
Die
Kommunikation
über den Körper,
über die Sprache
– was passiert,
wenn diese
beiden
Artikulationsmöglichkeiten
nicht mehr
übereingingen.
|

29.9.2007
Der erste
Eindruck
"Wie
stolz, die hier
geknickt liegt,
noch vor Kurzem,
Hoch auf des
Lebens Gipfeln,
rauschte sie!"
Eine durch die
Hand des Teams
modernisierte
'Penthesilea',
im Krieg vor
Troja
tatsächlich nur
Folie, im Kampf
mit sich selbst,
auf der Suche
nach dem ihr von
der Mutter auf
deren
Sterbelager
verheißenen
Mann:
"Du wirst
den Peleïden dir
bekränzen -
Werd' eine
Mutter, stolz
und froh, wie
ich"
Hier die
Vorsehung, die
aber beides,
Vereinigung und
Mutterglück
ausgrenzt. Es
bleibt ihr nur
der Kampf um
ihn.
Eine
'Nicht-Heldin',
hoch
aufgeschossen,
ungebärdet, roh,
wild in den
Gängen, den
Körperbewegungen,
die Bühne
raumgreifend
durchschreitend,
einnehmend,
atemlos, gehetzt
vom Suchen nach
dem Mann, der
ihr gebührt, ist
er denn im Kampf
überwunden.
Die Amazone, die
starke Frau
gegen den Mann,
der das
Patriarchat
vertreten soll -
ausgerechnet er
- ansonsten
knallharte
Männer an der
Macht - ein
Matriarchat
unbekannt und
unerwünscht.
Nur einer kann
glänzen in einer
Beziehung - sie
oder er.
Ihr
Kampfgeschrei,
ihr Auffordern
der eigenen
Gefolgschaft bei
der Suche nach
ihm, laut, beim
weiter
Lauterwerden,
die Stimme ohne
Körper, kehlig,
der Text geht
verloren.
Silke Heise
- Gefühle ihr
unbekannt, der
Liebe nicht
fähig,
ungeschlacht,
auf des Lebens
Gipfeln,
aufrecht im Tod,
in der Liebe am
Boden, im Sand,
spielerisch ins
Wasserbecken mit
dem Erwählten.
Sie findet den
Peleïden, der,
um sie zu
gewinnen, sich
aufgibt - sie
soll ihn
besiegen können
und besitzen.
Michael Haake,
fachübergreifend,
mal 'Hamlet',
mal 'Orest', mal
'Licht', mal 'Elwood'
- nun 'Achill',
in der 'Ilias'
von der Mutter
als Mädchen
verkleidet, um
nicht in den
Krieg zu müssen.
Da aber trifft
er 'Patroklus' und
alles ist
verständlich.
Ein sehr
jungendlicher
Loser,
schmächtig
(trotz Waldlauf
und Liegestütz),
mädchenhaft,
apart, folgt den
schicksalhaften
Vorgaben und
fügt sich der
Frau - niemand
hindert ihn, ihr
zu Willen zu
sein, er
scheitert - muss
scheitern, da er
sich selbst von
vornherein
aufgibt und nur
sie sieht - kaum
erstaunt,
ergeben in ihren
Herrschaftsanspruch
"Wie junge
Rosse
Zum Duft der
Krippe, die ihr
Leben nährt."
und
"Es soll
geschehn."
und 'Diomedes'
kommentiert
"Er will
sich bloß ihr zu
gefangen geben."
'Achill' / Haake
verliert sich in
ihr, hat aus
sich heraus
keine Kraft,
keine Chance,
will auch keine
gegen die ihn
anspringende
Ungestüme, gegen
die, die eigene
Angst vor dem
Mann,
ankämpfende
zwanghaft
besitzergreifende
Frau.
Über eine
geschliffenere
Sprache, ein
strafferes
Auftreten
versucht er
neben ihr Figur
zu machen, die
gerade von ihren
Hunden, den
Elefanten, den
Sichelwagen
kommt.
"Nun denn – mich
rufen mancherlei
Geschäfte,
So laßt mich
gehn."
und
"die
Schaaren will
ich mustern"
hat keine Lust
zu plaudern -
und
"Sie ist mir
nicht,
Die Kunst
vergönnt, die
sanftere, der
Frauen!"
und
keine Chance
für ihn, gegen
sie anzukommen.
"Im
blut'gen Feld
der Schlacht muß
ich ihn suchen,
Den Jüngling,
den mein Herz
sich auserkohr"
Beispielhaft
diese Passage,
wie Silke Heise
über die
Tongebung
differenzieren
kann und
stotternd,
echauffiert
ausspielt, die
Verlegenheit, in
Liebesdingen
unerfahren zu
sein und die
drohende Gefahr,
sich deshalb
darin zu
verlieren.
|

Susanne
Ellinghaus
schafft eine
'vor den Toren'
- Szenerie mit
Sand,
Wasserbecken,
Brüstungen der
wehrhaften Stadt
- dort das
Geschehen einer
nicht
gewachsenen,
sondern aus dem
Stand
erschaffenen,
Organisationen
und
Überzeugungen
sprengenden und
so nicht
funktionieren
könnenden
Beziehung.
Ledermäntel,
Schnürgewänder -
Sommerhosen,
weiß.
Rituale der
Kämpfer - mehr
Tai
Chi-Entspannungsübungen,
denn
kriegerische
Ertüchtigungen
von
Sebastian
Eilers
choreographiert,
gerade für die
Männer 'Odysseus'-Paul
Kaiser, 'Diomedes'-Stefan
Bräuler,
Antilochus'-Michael
Heuberger,
'Hauptmann/Herold'-Florian
Münzer,
diese doch nur
Nebensache an
der Seite der
Frauen.
Doris Dubiel
als
Oberpriesterin
anfänglich
erhaben
geheimnisvoll
raunend, dann
mit in
der Angst
unpassend in den
Diskant
steigenden
Stimme.
'Prothoe'-Silvia
Rhode, 'Meroe'-Nikola
Norgauer, 'Asteria'-Anna
Dörnte, 'Hauptmännin'-Ester
Kuhn - als
Pulk der
Amazonen - kaum
auffallend.
Petra
Wüllenweber
kann die Scharte
ihrer
Regensburger
'Maria
Magdalena'
auswetzen.
Stimmte dort von
der Besetzung
über das
Bühnenbild bis
zu Kostümen und
letztlich
Regie
nichts, zeigt
sie hier ein in
sich
geschlossenes
Drama.
Leider nutzt sie
die Möglichkeit,
gerade vor dem
Zusammentreffen
mit 'Achill',
die Handlung zu
kürzen, nicht
genügend.
War der
'Krug'
zu stark
zusammengestrichen,
ist hier zu viel
offen, was den 'Regensburger-Nicht-Kleist-Kennern'
dann schwer zu
vermitteln ist,
auf
Unverständnis
stößt und in
Gelächter endet.
Der Besuch
schwach, der
Beifall fast
enthusiastisch -
allein schon ob
der
Gedächtnisleistung
- sehr zur
Genugtuung des
ganzen
Ensembles,
speziell aber
zur
Freude der
Regisseurin -
ihr fiel hörbar
ein Stein vom
Herzen.
Abwarten, was
sie aus 'Happy'
in Hannover
macht.
|

Als Premieren-Abonnent
Theater Regensburg
und Abnehmer von Karten aus dem freien Verkauf
dieses und anderer Theater
veröffentliche ich auf dieser privaten Homepage meine
Meinung.
Ich
verstehe die Besprechungen und Kommentare nicht als Kritik um der
Kritik willen,
sondern als Hinweis auf nach meiner Auffassung zu
Geglücktem oder Misslungenem.
Neben Sachaussagen enthalten die
Texte auch Überspitztes und Satire.
Für diese nehme ich den
Kunstvorbehalt nach Artikel 5 Grundgesetz in Anspruch.
In die
Texte baue ich gelegentlich Fehler ein, um Kommentare
herauszufordern.
Dieter Hansing
|