| |
|
Announcement
Theater
Regensburg
Musikdrama in drei Akten
Dichtung nach Victorien Sardou
von Luigi Illica und Giuseppe Giacosa
Musik von Giacomo Puccini (1858-1924)
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Musikalische Leitung: Tetsuro Ban
Inszenierung: Reto Nickler
Bühne und Kostüme: Karel Spanhak
Als Puccini 1889 Sarah Bernhardt in Sardous Drama als Tosca auf der Bühne erlebte, war er sofort gefesselt von diesem Sujet. Obwohl er des Französischen nicht mächtig war, ließ ihn der Eindruck, dass es sich hier um einen guten Opernstoff handele, nicht wieder los. Der Erfolg, der sich nach der Uraufführung 1900 in Rom einstellte, gab dem Gespür Puccinis für bühnenwirksame Sujets recht.
Die Oper ist nach der Sängerin Floria Tosca benannt, die sich nie mit Politik beschäftigt hat und der die Erkenntnis widerfährt, dass sie das nicht davor bewahrt, dass die Politik sich mit ihr beschäftigt. „Ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe“, so beginnt ihre Arie, die sie in höchster Bedrängnis singt. Der Polizeichef Scarpia fordert von ihr Sex als Gegenleistung dafür, dass er die Freilassung von Toscas Geliebtem unterschreibt. Über Toscas Kunst verfügen andere. Über ihre Liebe verfügt sie selbst und tötet dafür den Tyrannen Scarpia.
Der geliebte Mann, der Maler Mario Cavaradossi, versteckt als politisch denkender Künstler den vom Unrechtsstaat verfolgten früheren Konsul von Rom. Cavaradossi wird verhaftet und gefoltert, doch er bleibt standhaft und verrät das Versteck nicht. Das Spitzelsystem Scarpias funktioniert jedoch auch ohne Scarpia. Cavaradossi wird hingerichtet.
Nicht die Liebe siegt über die Macht, sondern die Macht über die Liebe. Dennoch bleibt Liebe eine Alternative zur Macht – gewiss nicht eine politische, sondern die moralische und humane Alternative.
| Besetzung
|
| |
| Floria Tosca |
Victoria Safronova |
|
|
| Mario Cavaradossi |
Enrico Lee |
|
|
| Baron Scarpia |
Adam Kruzel |
|
|
| Cesare Angelotti |
Sung-Heon Ha |
|
|
| Mesner |
Ruben Gerson |
|
|
| Spoletta |
Michael Berner |
|
|
| Sciarrone |
Sang-Sun Lee |
|
|
| Schließer |
Mikhail Kuldyaev |
|
|
| Ein Hirt |
Elena Lemke |
|
|
|

|
Inzwischen scheint das Theater Regensburg nicht schlauer geworden zu sein.
War noch bei der 'Manon' dem Original entsprechend die Rede vom Verdursten in der Wüste, so sah das Publikum das Paar Manon / Des Grieux auf der Bühne in einer Bar, an den Wänden Regale mit Massenhaft Flaschen, so dass ein Verdursten kaum möglich gewesen wäre, zumal bei der vorausgegangenen Schießerei kaum die Wasserleitung getroffen wurde und austretendes Wasser die Bühne befeuchtete. Außerdem wären bei den vorher erschossenen Barbesuchern diverse Handies zum Alarmschlagen zur Verfügung gewesen.
Natürlich kann man sich bei jeder Inszenierung heutigen Stils auf die Metapher rausreden, die neue Sicht auf das Werk und die Choreographie sei ja dem Original ähnlich und damit erlaubt, alles 'im übertragenen Sinne' zu sehen.
Die Hinweise im Internet ermöglichen wieder einmal den Blick hinter die Kulissen der Anstalt öffentlichen Rechts.
Da wird noch am Tag der Premiere ein NN angegeben für den jungen Hirten und für die Damen Victoria Safronova und Katerina Sokolová-Rauer wurde vom Theater Regensburg jeweils eine neue Rolle erfunden, die Fa l via Tosca für
Victoria Safronova , und die F l avia Tosca für Katerina Sokolová-Rauer.
Ist es nicht ungeheuerlich wie die teuer aus öffentlichen Geldern bezahlten Herrschaften des Oberpf. Metropol-Theaters mit Inhalten und Figuren der Stücke umgehen und das Publikum hinters Licht führen.
|
|

|
Die Situation in der
'Tosca' hat
einen realen
historischen
Hintergrund.
Der erste
Koalitionskrieg
konnte von
Frankreich auch
dadurch gewonnen
werden,,
dass die
Gegenmächte
durch
Friedensvereinbarungen
aus dem
Kriegsverbund
herausgelöst
wurden.
|
"[...] Im April
1792 erklärt das
revolutionäre
Frankreich,
angestachelt
durch eine
verbale
Provokation,
Österreich den
Krieg.
Preußische
Truppen dringen
sofort tief nach
Frankreich vor.
Weitere
europäische
Mächte, darunter
England und die
Mehrheit der
deutschen
Staaten,
schließen sich
der
antifranzösischen
Koalition an.
Durch die
Einführung der
allgemeinen
Wehrpflicht
schafft sich die
Revulutionsregierung
ein nahezu
unerschöpfliches
Reservoir von
hochmotivierten
'Bürgersoldaten';
aus einem
französischen
Verteidigungskrieg
wird ein
Eroberungsfeldzug.
Außerdem wird
eine neue Form
der
Kriegsführung
entwickelt. Die
Truppen ernähren
sich aus dem
Land, damit
werden die
französischen
Armeen
wesentlich
beweglicher, da
sie weniger Troß
benötigen.
Trotz der
Erfolge des
Erzherzogs Karl
im Reich endet
der 1.
Koalitionskrieg
1797 mit einer
österreichischen
Niederlage durch
die Siege
Napoleons
Bonapartes in
Italien. Der
Aufstieg
Napoleons hatte
begonnen.
Der 1798
beginnende 2.
Koalitionskrieg
trifft besonders
Bayern hart.
Kriegsentscheidend
ist im Dezember
1800 die
Schlacht von
Hohenlinden, die
insgesamt 15 000
Soldaten das
Lenen kostet.
Das Schicksal
des alten Reichs
ist besiegelt.
[...]"
'1806 - Das Ende
des Heiligen
Römischen Reichs
Deutscher
Nation'
Stadt Regensburg
- 2003
|
Die zweite
Koalition aus
Großbritannien,
Österreich,
Russland, dem
Osmanischen
Reich, Portugal,
Neapel und dem
Kirchenstaat
gegen Frankreich
scheiterte
ebenso.
Deutschland
unter Friedrich
Wilhelm III.
verhielt sich
neutral - im
ersten
Koalitionskrieg
waren Herzog Ferdinand von Braunschweig und
Herzog Karl
August von
Sachsen-Weimar-Eisenach
an dem Gefecht
am 20.9.1792
beteiligt, das
mit der Kanonade
von Valmy und
dem Vorrücken
der
französischen
Revolutionstruppen
die weitere
Stärkung
Napoleons
vorgab.
Um den
Österreichern
wieder in
Italien
entgegenzutreten,
überquerte er
die Alpen und
musste den Feind
in der Poebene
erst suchen, zog
dabei seine
Truppen weit
auseinander und
stieß am 14.
Juni 1800 bei
Marengo auf die
weitaus stärkere
Streitmacht von
General Michel
Friedrich Melas.
Am Nachmittag
musste Napoleon
sich
zurückziehen und
General Melas
telegraphierte
einen Sieg nach
Wien.
Am Abend traf
General Louis
Charles Desaix
mit seinem Korps
ein und
verwandelte die
vermeintliche
Niederlage in
einen Sieg der
Franzosen,
verlor dabei
aber selber sein
Leben.
|
|

|
Victorien Sardou (1831 - 1908) französischen Dichter machte den 14. Juni 1800 zur Basis seines Werkes 'La Tosca' , das er Sarah Bernardt widmete und das mit ihr am 24. November 1887 als 'Pièce en cinq actes' uraufgeführt wurde.
Die Schlacht von Marengo ist für Sardou nicht nur Kulisse, sondern bildet die Basis für die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern zweier gegensätzlicher Gesellschaftssyteme.
Baron Scarpia verkörpert den eiskalten, brutalen, frömmelnden Katholiken und Royalisten, der seine persönlichen Wünsche mit Perfidie und äußerster Brutalität durchzusetzen versteht.
Ihm gegenüber Cesare Angelotti und Mario Cavaradossi als Verfechter des Republikanismus, letzterer, Künstler, Freigeist mit politischen Ambitionen und Überzeugungen, für die er sein Leben aufs Spiel setzt und verliert.
Puccini sah das Werk 1889 in Paris und war überzeugt, einen für ihn passenden Stoff gefunden zu haben, aber Sardou wollte seinen 'Hit' nicht einem damals noch fast unbekannten Komponisten zur Vertonung übergeben, auch hatte sich Alberto Franquetti das Sujet reservieren lassen. Nach Fertigstellung der Bohème konnte Verleger Ricordi das Stück für Puccini sichern.
Guiseppe Giacosa, Luigi Illica wie auch Puccini bearbeiteten die Vorlage und bezogen Sardou in die Arbeit ein. Die Handlung wurde von fünf auf drei Akte reduziert und eine Reihe von Figuren nicht übernommen.
Die Hauptfiguren verloren an politischer Kontur, da Puccini mehr die Liebesgeschichte und wieder einmal die Frau als Verliererin in den Vordergrund stellen wollte. Er selber recherchierte in Rom, um die Schauplätze und die Stimmungen vor Ort für sich weitmöglich zu übernehmen und umzusetzen.
Geblieben ist die Situation am Tag Schlacht von Marengo und wurde im Text ausdrücklich erwähnt.
Zwar meint der Regensburger Theaterdirektor - nach seiner Aussage im Interview vom 26.6.2009 -
http://www.oberpfalznetz.de/demobeilagen/1885142-451-wer_rettet_die_kultur,1,0.html#top
ausführen zu müssen:
"Ich mache hier Theater für Regensburger."
Sein Bemühen in allen Ehren, allerdings hat er dann auch Angaben, die dem Regensburger Zuschauer die Situation am Tag des Geschehens verdeutlichen, darzulegen.
|
1. Akt
EINIGE SCHÜLER
Aber was ist passiert?
MESNER
Wisst ihr nicht? Bonaparte ... der Schurke . . .
atemlos
Bonaparte ...
ANDERE SCHÜLER
nähern sich dem Mesner und umringen ihn, während
weitere hereindrängen,
um sich mit ihnen zu vereinigen
Nun? Was war?
MESNER
Aufgerieben, geschlagen
und zum Teufel gejagt!
SCHÜLER, SÄNGER.
Wer sagt das?
- Ein Traum!
- Ein Märchen!
MESNER
Es ist die reine Wahrheit!
Eben traf die Nachricht ein!
Und heut abend
ein grosser Fackelzug
eine festliche Gesellschaft im Palazzo Farnese
und eine eigens geschriebene
neue Kantate
mit Floria Tosca!
Und in den Kirchen
Lobpreisungen des Herrn!
Nun geht euch anziehen,
kein Geschrei mehr!
[...]
2. Akt
SCIARRONE
stürzt keuchend herein
Euer Gnaden, welch eine Neuigkeit!
SCARPIA
überrascht
Was soll diese betrübte Miene?
SCIARRONE
Eine Niederlage ist zu melden ...
SCARPIA
Welche Niederlage? Wie? Wo?
SCIARRONE
Bei Marengo ...
SCARPIA
ungeduldig, schreiend
So rede endlich!
SCIARRONE
Bonaparte hat gesiegt ...
SCARPIA
Melas!
SCIARRONE
Nein. Melas ist auf der Flucht! ...
|
|
|
|

|
Das ausgehende 19. Jahrhundert brachte den Verismo - schonungslose Zeichnung von Milieu und Stimmung auf die Opernbühne, Italien und Frankreich waren die Länder, in denen die Wahrheit des Lebens schon seit 1830 in der Literatur dem Publikum dargeboten wurde.
1890 erschien 'Cavalleria rusticana' von Pietro Mascagni (1863–1945). 1892 kam 'I Pagliacci' von Ruggiero Leoncavallo (1857–1919) hinzu - beide Werke meist zusammen auf den Bühnen gezeigt.
'La Tosca', das Stück von Victorien Sardou eignet sich - wie schon als Werk auf der Sprechbühne - besonders für eine Vertonung im Stil dieser Zeit, da alle Möglichkeiten geboten sind, Wahrhaftiges aus Quälerei, Grausamkeit, Schrecken, Schönheit, Leidenschaft, Leid, Grandezza und vor allem in der Vereinigung von Eros, Weihrauch und Sadismus auf die Bühne als Musikdrama zu bringen.
Sardou hatte Verdi sein Stück 'La Patrie' zur Vertonung angeboten, der Altmeister aber antwortete, wenn er nicht schon so alt sei, würde er gerne 'La Tosca' übernehmen - Verdi hatte damals das 83. Lebensjahr schon erreicht.
Franchetti, der die Rechte an 'La Tosca' von Sardou erworben hatte, verzichtete 1895 wie er es schon bei 'André Chénier' zugunsten von Umberto Giordano tat.
Woher aber Sardou die Idee zu diesem Stück hatte, dass bereits auf der Sprechbühne zum Renner wurde, ist bisher ungeklärt. Er selber, der des Plagiats beschuldigt wurde, behauptete stets, er habe die Grundidee einer Geschichte aus den französischen Religionskriegen des 16. Jahrhunderts entnommen, Schauplatz sei Toulouse gewesen, wo der katholische Polizeioffizier de Montmorency - in ähnlicher Weise wie Scarpia - an einer protestantischen Bäuerin gehandelt habe.
Sardou - ein gebildeter Mann - übertrug 'La Tosca' ins von Österreich besetzte Italien.
|
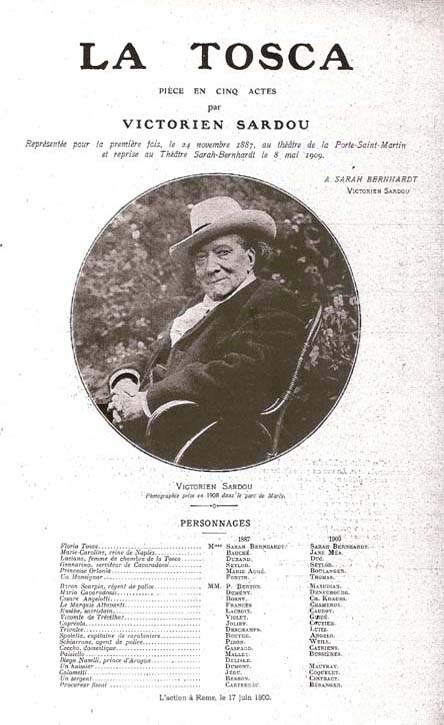 |
|
|

|
Mit der
Französischen
Revolution
begann in Europa
das Zeitalter
der Nationen,
Nation nun nicht
mehr verstanden
als (Geburts)Stand,
sondern als
Gemeinschaft von
Menschen
gleicher
Sprache,
Geschichte und
Kultur, die sich
selbst bestimmen
(Selbstbestimmungsrecht).
Überall in
Europa fingen
die Völker an,
ihre Sprache und
Geschichte zu
erforschen und
eine eigene
nationale
Identität zu
entwickeln.
In den letzten
Jahren des 18.
Jahrhunderts
versuchten
italienische
Provinzen und
Städte die immer
drückender
werdenden
Machtstellung
Österreichs
abzuschütteln.
Napoleon
unterstützte
diese
Bestrebungen und
wurde damit zum
Symbol für eine
Republik.
Die
Revolutionäre
erstarkten,
obwohl die
Franzosen sich
nicht viel
besser als
Besatzungsmacht
in Italien
verhielten als
die Österreicher
- trotzdem wurde
das eher
erduldet, weil
es langfristig
nationale
Freiheit
bedeuten konnte.
Nur Bauern und
Adel, von der
Kirche
aufgeputscht,
kämpften gegen
die Franzosen,
die die
Aufstände
niederschlugen,
den Papst
gefangen nahmen
und nach Valence
im Süden
Frankreichs
abtransportieren.
Der Kirchenstaat
wurde aufgelöst,
die Römische
Republik
ausgerufen.
Napoleons
Gegenspielerin
war Maria
Carolina,
Tochter von
Maria Theresia
und Gattin des
schwächlichen
Königs Ferdinand
IV von Neapel,
Sohn von König
Charles III von
Spanien und
Maria Amalia von
Sachsen. Jede
Art von
Revolution, ob
republikanische
Begeisterung
oder
Voltaire'sches
Gedankengut
waren ihr
zuwider, zumal
ihre Schwester
Marie
Antoinette, mit
der sie als Kind
in enger
Verbindung am
Hof von
Schönbrunn
aufgewachsen
war, am 16.
Oktober 1793 in
Paris
guillotiniert
wurde.
In der Zeit, da
Napoleon in
Ägypten kämpfte,
zerschlug ein
österreichisch-russisches
Heer unter
General Suworow
die jungen
italienischen
Republiken. Rom
fiel im
September 1799
nach schweren
Kämpfen
überwältigt von königlich-neapolitanischen
Truppen. Maria
Carolina
übernahm in
diesem Moment,
da Papst Pius
VI. in Valence
starb, auch die
Herrschaft in
Rom.
Sie ließ
Säuberungen
durchführen, Jagd auf
Verräter,
Republikaner,
Revolutionäre
machen.
Tausende
schmachteten in
Kerkern ohne
Anklage und
wurden von Maria
Carolinas
Schergen
umgebracht.
Unter den
Verfolgten war
auch Cesare
Angelotti, der
von den
Franzosen als
Konsul von Rom
eingesetzt war.
An jenem 17.
Juni 1800 floh
er aus dem
Gefängnis zur
Marchesa
Attavanti,
seiner
Schwester. Er
verbarg sich in
deren
Privatkapelle,
die ein
Seitenraum der
Kirche Sant'Andrea
della Valle ist.
|
|

|
Mit seiner Verlautbarung vom Tag der Premiere gibt das Theater Regensburg den Hinweis:
|
"[...] Die
Handlung der
Oper spielt
innerhalb von 24
Stunden im Jahr
1800 in Rom.
Neun Monate
zuvor ist die
Republik zu Fall
gebracht worden.
Mittlerweile ist
ein
Spitzel-Staat
entstanden, als
dessen
Protagonist der
Polizeichef
Scarpia mit
aller Härte und
Perfidie
vorgeht. Dieser
Spitzel- und
Folterstaat soll
den Rachefeldzug
gegen die
früheren
Machthaber und
Freunde der
republikanischen
Staatsform voran
bringen. [...]"
|
Nun, es war zu erwarten, der Text mit dem die Situation um die Schlacht bei Marengo beschrieben wird, stand im Gegensatz zu dem Geschehen auf der Bühne, was zwei Damen zum Anlass nahmen, nach der Vorstellung zu kommentieren.
|
|
|

|
Frau Doblinger:
Mei, Frau Hirneis, gell, geht's wieder los, die Theatersaison!Frau Hirneis:
Ja, und glei mit 'Tosca', riachan's amol, i hob mit glei mit 'Tosca' angesprüht, bevor ma aus'm Haus san.
Frau Doblinger: Und is ihr Mo wieder net dabei?
Frau Hirneis:
Na, Frau Doblinger - der mog nimmer, der sogt, weils allerweil was anders spieln als wos im Internet steht, drum geht er nimmer. Er sagt, das Schlimmste war die 'Norma' und die 'Manon' - so an Schmarrn!
Und do bei dera 'Tosca' is doch a net anders - do sogns, es wär ois an oam Dog in Rom und zwar wia der Napoleon ganz Europa unterworfa hot - und wos zoang's irgendwos vom Mussolini oder so.
Do, des Fenster auf der link'n Seit'n, des gibts doch gornet in dera Kirchn. Und der oarme Moler, ollerweil im hellen Mantel wie unser OB wenn er wieder Kränze niederlegt.
Und Sie - die Tosca in dem Kleidl - is des vo der Telekom? - mit dera Bruillen, die oallerweil von da Nosn fallt - aber das schlimmste ist doch die Stola im letzen Akt - also man glaubts net - des schaugt aus wia von am zersaust'n Osterhas'n!
Und so vui Nebel auf dera Bühn', des hättens scho im ersten Akt macha soll - damit man des Grauen net sicht.
Mei, schlimm, gell, wenn de kloanste Neb'nrolln am besten o'kimmt. Der Spoletta vom Michael Berner, wann der nu g'hinkt hätt', dann hätt ma den Goebbels g'habt - aber aa ohne des, der Mo is guat, der ziagt eine rode Spur hinter sich her.
Super.
Sonst, koa Wunder, dass des koam g'fallt - die Leut sitzen umeinander und kenna si net aus. Wenigsten geht die Übertitelung - da homs die letzten 100 Watt Birn' einig'schraubt - jetzt ko man wenigsten lesen, was auf der Bühne net is.
Von der Engelsburg springt die guade Frau a net - guad, a Frau mit solche Fiaß lässt man in Rua, aber stimmen tuts net.
D'Zeitung hot g'schrieb'n, dass der 'Todeshopser' g'stricha is - was isn des für a Sprach, schon wieder so a Kas, 'Todeshopser'...
Sie, Frau Doblinger - ui, wos i grod seh'! Mei des soit ja heid bloß a Vierttlstund' dauern, de ganze Oper! Do, schaungs: Spieldauer 1/4 Stunden - wenn's a se dro g'haltn hätt'n, fuchzehn Minuten hätt'n g'langt!.
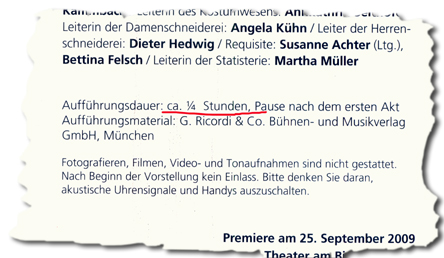
Mei Mo, der Sepp, werd sog'n:
wos regst di denn so auf, geh halt net hi - bleede Kuah - du woaßt doch scho lang, dass die's net kenna.
|
Um 'Missverständnisse zu vermeiden:
Ich verstehe diese Besprechungen und Kommentare nicht als
Kritik um der Kritik willen, sondern als Hinweis auf - nach
meiner Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes.
Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und
Satire.
Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,
Grundgesetz, in Anspruch.
In die Texte baue ich gelegentlich Fehler ein,
um Kommentare herauszufordern.
Dieter Hansing

|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|


|
|


|
|






|
|

|
|
Werbung |
|

|
|
|
|
Werbung |
|
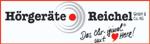
|
|
|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|
|
|

|

|
 |
|