| |
|
|
|
|
|
Der Besuch
des Einführungsvortrages 'Manon' ließ zu wünschen übrig.
Wenn zweidrittel der Sitze belegt waren, kann man von einigermaßen
richtigen Angaben sprechen.
Sonst strömen doch Heerscharen von RegensburgerInnen in diese
Veranstaltungen.
Dabei hatte Frau Bernau als Sprecherin des Theaters Regensburg über
die MZ am
18. Juni 2008 doch mitteilen lassen:
"das macht im Schnitt nur 50 Cent aus."
Hier wirke sich diese Preiserhöhung ja doch gar nicht aus, denn der
Besuch eines Einführungsvortrages zu einer Neuproduktion ist
doch gebührenfrei.
Dennoch stellt sich die Frage, "50 Cent mehr für Theater" - meint (ge)
für Theater, das die Verwaltung der Stadt veranstaltet z.B. die
Bekanntgabe des Programms des Bayerischen Jazz-Weekendes am
22.6.2008 um 10.30 Uhr im Hause der REWAG - zu der nur zwei
Medienvertreter erschienen: wer hatte denn da eingeladen?
Oder meinte Frau Bernau das Theater der Stadt, 50 Cent mehr und für
was?
Täglich, stündlich oder 'minütlich'?
|
|
|
|
|
|
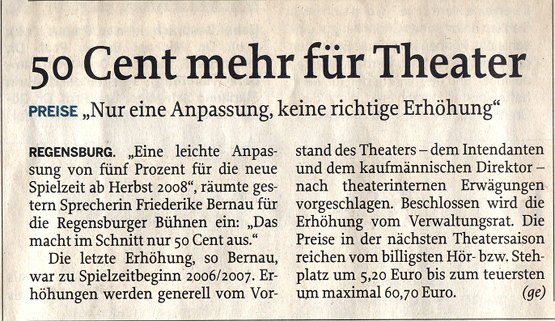
|
|
|
Nach Meinung von Frau Musik-Dramaturgin Schmidt
habe sich Puccini nach den ersten Werken 'Le Villi' und 'Edgar' in
einer misslichen finanziellen Lage befunden - glücklicherweise aber
habe er im Verleger Ricordi schon früh einen Menschen gehabt, der an
ihn, Puccini, glaubte, denn, sollte die dritte Oper kein
Erfolg werden, müsste er sich eine andere Profession suchen, so
meinte er.
Wohl um dies abzuwenden, habe sich Puccini an der Suche nach
einem Thema für diese neue Oper
beteiligte
.
Man sei auf 'Manon' gekommen, wovon Ricordi nicht begeistert gewesen soll, da
dieses Thema von Massenet, die Geschichte dieser Flatterhaften,
schon vorweg genommen hatte. Puccini aber sei unbekümmert genug
gewesen, er
werde seine Heldin als Italienerin darstellen, gegenüber der Französischen von Massenet.
Endlich eine Heroine, an die er glauben könne.
Im Laufe der Zeit hätten sich eine ganze Reihe von Librettisten an
der Erstellung des Textes beteiligt - selbst Ricordi arbeitete mit,
hauptsächlich aber in der Form, dass er Illica ins Gespräch brachte,
der später dann die Texte für 'Bohème', 'Tosca' und 'Butterfly'
schrieb.
Puccini meinte, es müssten zur Uraufführung alle am Text Beteiligten
oder keiner genannt werden.
Herr Generalmusikdirektor Grüneis - heute im braunen Reiseanzug, das
Hemd nicht in die Hose gesteckt, sondern leicht über ihr hängend
getragen, das an den Manschetten nicht zugeknöpfte Hemd schaute
leger aus den Sakko-Ärmeln, dazu weit sichtbar, ganz GMD-like, die
leuchtend blauen Söckchen - führte eloquent wie gewohnt und fachlich
qualifiziert,
vom Publikum hoch geschätzt,
aus, dass 'Manon' als drittes Werk Puccinis
ähnlich dem 'Holländer' von Richard Wagner als Frühwerk betrachtet
werden könne.
Puccinis 'Edgar' habe auch schon große Momente und werde nach seiner
Meinung zu unrecht so wenig gespielt, und doch seien 'Edgar' wie
auch 'Le Villi' eher Gesellenstücke Puccinis, da suche er noch in
verschiedenen Schubladen nach seinem Stil. In der Orchestersprache
könne man schon Dinge des späteren, des reifen Puccini finden - mit
der 'Manon' trete der eigentliche Puccini auf den Plan.
Ricordi habe in der ganzen Verzweiflung das richte Sujet für die
dritte Puccini-Oper zu finden, den Komponisten nach Bayreuth zu den
Wagner-Festspielen geschickt. Dies Anhören Wagner'scher Musik sei
nicht spurlos an Puccini vorüber gegangen, in der Komposition zeige
sich dies deutlich im harmonischen Denken vor allem für Puccinis
Orchestersprache mit ihrem Raffinement.
Verdi, der zum gleichen Zeitpunkt mit seinem 'Falstaff' auf die
Bühnen kam, für sich keine Notwendigkeit sah, sich Wagner
anzueignen, warnte auch andere Komponisten, nicht dem 'Wagnerismo'
zu verfallen. Italien habe einen regelrechten Kulturkampf zu
bestehen gehabt und Verdi mahnte, Italien habe seinen eigenen Stil
und brauche Wagner nicht. Auch könne man mit einem Kontrabass und
einer Piccoloflöte in Italien effektvoll instrumentieren.
Der Orchesterapparat habe sich gegenüber den Frühwerken Puccinis
nicht verändert, es sei die klassische Orchesterzusammensetzung mit
vier Hörnern, drei Posaunen - eine Tuba sei hinzu gekommen, was
vorher nicht gewesen sei - etwas mehr Schlagzeug und eine
Bassklarinette, mit der Verdi im 'Otello' auch etwas experimentiert
habe. In der hochromantischen weichen Orchestersprache Wagners sei
z.B. König Marke im 'Tristan' dagegen ohne Bassklarinette nicht zu
denken. Der ganze Holzbläsersatz basiere hier auf dem Fundament der
Bassklarinette.
Bei Verdi seien es die Fagotte gewesen, die den Holzbläserklang
ausmachten, wollte er mit der Zeit gehen, dann habe er vier Fagotte
wie im 'Otello' und im 'Requiem' benutzt.
Puccini nehme in der 'Manon' die Bassklarinette und dazu zwei
Fagotte als Tenor-Instrumente, was den Klang schwierig für die
Sänger mache, aber einen verblendeten orgelmäßigen Holzbläserklang
hervorrufe und mit den Hörnern zusammen in der hohen und mittleren
Lage ergebe sich ein schwerer, fast schwüler Orchesterklang.
|
|
|
|
|
|
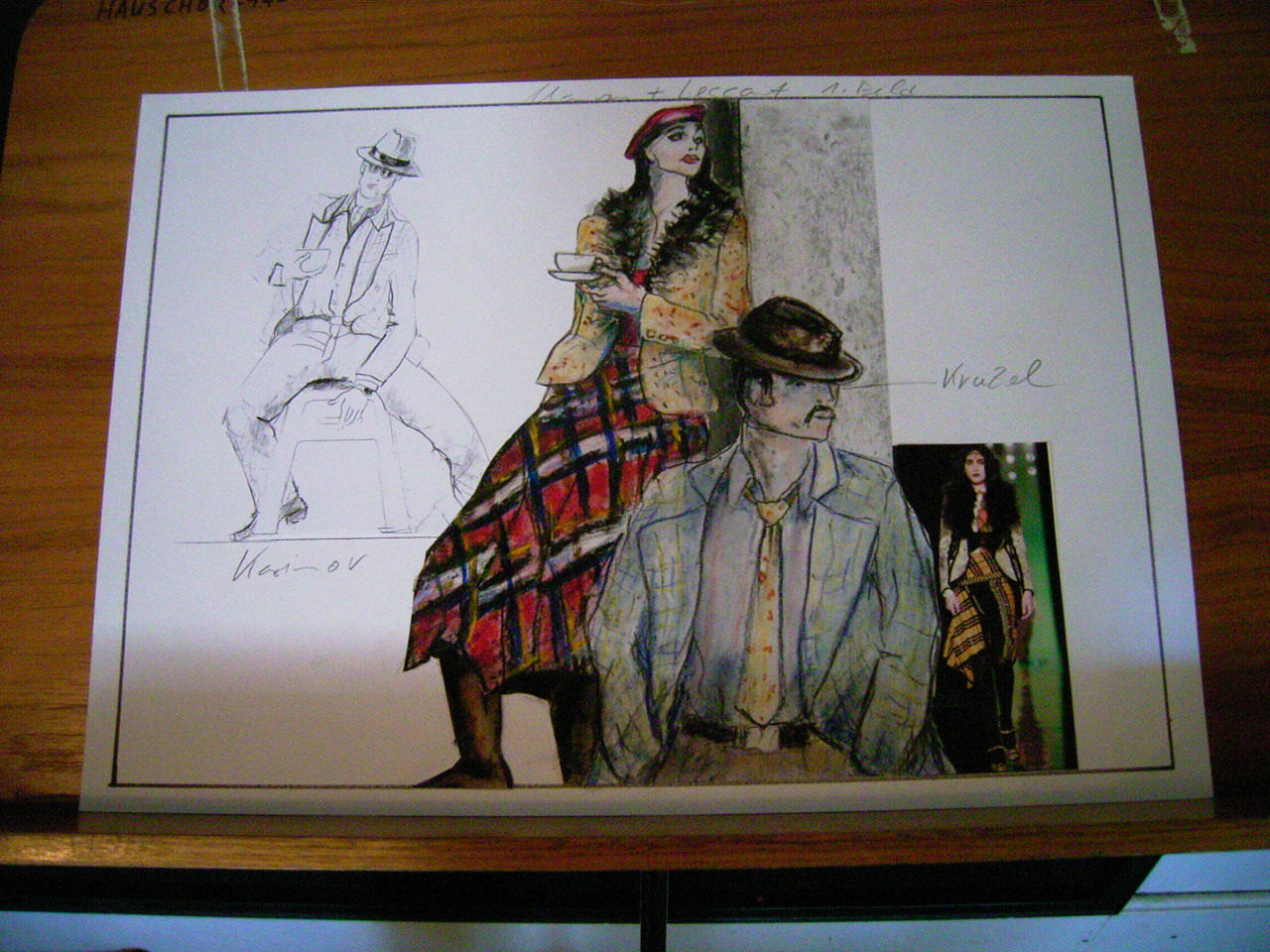
Figurinen: Frank Lichtenberg
|
|
|
Frau Musik-Dramaturgin Schmidt erwähnte, das
Opernlibretto der 'Manon' sage wenig zu den Figuren, vornehmlich zu
der des Chevalier Des Grieux - der Roman Prevost's sei hier viel
deutlicher in der Zeichnung. Dagegen werde die Manon immer nur als
Nebenfigur in Bezug auf die Männer gezeigt.
Des Grieux lebe quasi in zwei Welten, er wisse, dass er Leidenschaft
zwar suche, sie aber nicht immer leben könne - diese Reibung führe
letztlich in die Katastrophe, da er mit seinen Leidenschaften nicht
zurechtkäme und auch zum Mörder werde.
Gezeigt würden immer wieder nur Ausschnitte - Szenen aus dem Leben
in den verschiedenen Akten - was dazwischen geschehe oder war,
erfahre das Publikum nicht direkt.
Auch werde nicht gefragt, aus welchen Gründen etwas passiere,
sondern die Fakten werden hingenommen, Leidenschaft komme über die
Menschen - warum, könne nicht ausgemacht werden - es passiere eben.
Die Handlung stimme mit den jetzigen Voraussetzungen nicht mehr
überein, eine Familie schicke heute die Tochter nicht mehr in ein
Kloster, weil man für sie, z.B. aus finanziellen Gründen, nicht mehr
sorgen könne. Sehr wohl aber gebe es die Situation, dass eine junge
Frau, sich von einem älteren Herrn aushalten lasse. Diese nun wegen
Prostitution anzuzeigen, auch das ist heute nicht so ohne weiteres
möglich, zumal die Delinquentin heute nicht so ohne weiteres mehr
nach Amerika deportiert werden könnte.
Das Thema: junge Frau macht sich an Reichen ran, käme auch heute vor
- Tatjana Gsell ein typisches Beispiel.
Manon lebe in einem Dreieck unter dem Einfluss ihres Bruders Lescaut
in einer Zweckgemeinschaft, in der Liebe zu Des Grieux und in der
finanziellen Abhängigkeit von Geronte, dem königlichen
Steuerpächter, wie die Rolle noch eine Woche vor der Premiere im
Internet durch das Theater Regensburg bezeichnet wird.
Diese Situation, das Motiv wollte man retten, es aber in heutigem
Licht zeigen. Die Personen treffen sich an öffentlichen Orten, um
z.B. schnell untertauchen zu können, wie Schnell-Restaurants, Mensa
- mit fast ständigem Personenwechsel. Im Gegensatz hierzu das
elegante Restaurant als Treffpunkt mit Geronte und der Abstieg
gekennzeichnet durch die Tätigkeit in einer Bar.
Die Gesellschaft - verkörpert durch den Chor - interessiere sich
nicht für die Protagonisten, das Leben derer laufe neben der
Öffentlichkeit ab. Ob diese sich für eine Liebensgeschichte oder am
sinnentfremdeten Tun der Einzelnen Anteil nähmen - konnte der
Regisseur nicht beantworten. Er höre in sich hinein und frage sich,
ob es wirklich eine Liebegeschichte sei.
Was aber ist Liebe für Manon?
Des Grieux treibe dahin - er suche nach dem Sinn des Lebens, er
suche nach etwas, das ihm Halt geben könne in dieser schicksalhaften
Geschichte, in die z.B. Lescaut nicht eingreift, um die Schwester zu
schützen.
Um die Individualität zu unterstreichen, habe man die
Polizeiauftritte herausgenommen dies fände er modern, so Regisseur
Horres - und dies sei auch für ihn homogen, meinte er, wenn man den
Widerspruch zulasse.
Darum gehe es in dem Stück, die Figuren seien in sich nicht logisch,
es sei schwer zu verstehen, was die da trieben.
Des Grieux, als Motor des Geschehens, verliebe sich tatsächlich in
Manon, er erkenne sehr wohl deren Beweggründe für ihr Tun.
Da werde ein neuer Handlungsstrang aufgerissen, der ältere Mann mit
Geld wolle unbedingt Manon haben, das Geschwisterpaar inszeniere
eine Flucht vor ihm und Lescaut gebe Ratschläge, Geronte solle
sich keine Sorgen machen, nach ein paar Tagen habe sich das wieder
gelegt, Manon verlasse Des Grieux und käme zu ihm zurück.
Des Gerieux aber tauche dann im zweiten Akt in der unmittelbaren
Nähe von Manon, Lescaut und Geronte in dieser Geldschwemme
unerwartet auf. Manon langweile sich mit dem kalten Geld, dem
Schmuck und sei vom lebendigen Des Grieux wieder hingerissen, der
aber ignoriere sie, die von allen, egal wem, geliebt werden wolle.
|
|
|
|
|
|
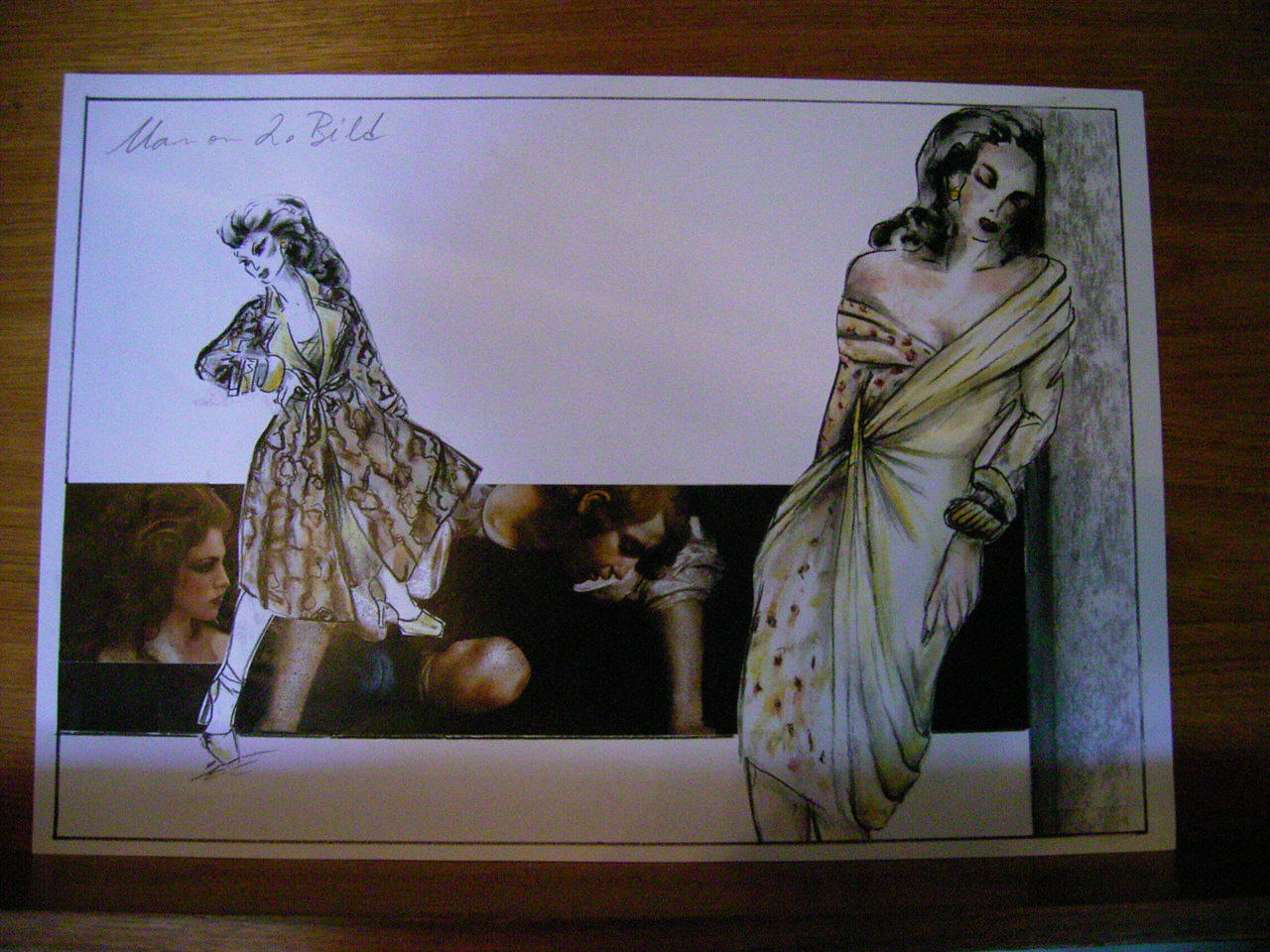
Figurinen: Frank Lichtenberg
|
|
|
|
|
|
In der 'Manon' schreibe Puccini mit den
verschiedensten musikalischen Farben für die unterschiedlichsten
Emotionen. Mit Bezug auf 'Bohème' und 'Butterfly', besonders aber
bei 'Fanciulla', sei ihm,
aus musikalischer
Sicht, mehrfach der Vorwurf gemacht worden, es sei Kitsch, was er
komponiere, er schreibe Filmmusik. Die Fülle des Wohllautes riefe
aus einer gewissen Übersättigung heraus nach etwas Neuem.
Wenn eine 'Bohème' oder eine 'Butterfly' nicht mit Überzeugung und
Emotionen angefüllt seien, ertränken für ihn diese Werke im Kitsch
und stürben in Schönheit - müsse er, der Herr Generalmusikdirektor
ernsthaft für sich gestehen. Aber schon Toscanini, der ja Puccinis
Werke teilweise uraufführte, bemängelt dies und bedauerte, dass
Catalani viel weniger erfolgreich war, trotz der viel wahrhaftigeren
Musik.
In der 'Manon' dagegen passe die Musik sehr wohl zu der
Übersättigung, in der die Figuren im Stück ohne Ziel, ohne Richtung
von einem Tag auf den anderen sich in einer leichtlebigen
Gefühligkeit befänden.
"Wir nennen uns Jugend und unsere Göttin ist die Hoffnung" -
nebulöser gehe es gar nicht.
Jung und dynamisch ist heute - was morgen ist:
wir hoffen.
Die Musik Puccinis treffe in diesem Stück genau diese Aushöhlung,
die Maskierung mit Gefühl so besonders gut.
Fallhöhen ergäben sich bei Puccini immer wieder, sei die Musik im
Moment besonders banal oder historisiert, so käme sehr schnell die
'dramatische Keule'.
Genre-Musiken, Rokoko-Musik, Schäferspiele, Menuette einzufügen,
pflegte Puccini. Er zeigte so zur eigentlichen Handlung musikalisch
eine andere Ebene, auf der sich das Gleiche, quasi 'en miniature',
abspiele.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Als Premieren-Abonnent von Theater
Regensburg und Abnehmer voll bezahlter Karten aus dem freien Verkauf
dieses und anderer Theater gebe ich hier meine subjektive Meinung
zu Gehörtem und Gesehenen
zur Kenntnis.
Ich
verstehe diese Besprechungen und Kommentare nicht als Kritik
um der Kritik willen,
sondern als Hinweis auf nach meiner
Auffassung zu Geglücktem oder Misslungenem.
Neben Sachaussagen
enthält diese private Homepage auch Überspitztes und Satire.
Für
diese nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5 Grundgesetz in
Anspruch.
In die Texte baue ich gelegentlich Fehler ein, um
Kommentare herauszufordern.
Dieter Hansing

|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |
|
|
|


|
|







|
|

|
|
Werbung |
|

|
| |
|
Werbung |
|
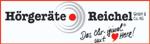
|
| |
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|
|
|

|
 |
 | |