|
|
|
|
|
|
|
|
Announcement
Theater
Regensburg
Buddenbrooks
von Thomas Mann (1875-1955)
für die Bühne bearbeitet von John von Düffel (*1966)
Inszenierung: Johannes Zametzer
Bühne und Kostüme: Hannes Neumaier
|
|
|
|
|
|
|
Thomas Manns Jahrhundertroman „Die Buddenbrooks“ ist heute wieder so aktuell
wie zur Zeit seiner Entstehung. Es geht um die Krise der Ökonomie, um den Verfall einer Gesellschaftsordnung und einer Familie. John von Düffel ist in seiner grandiosen Dramatisierung das Kunststück gelungen, die vielschichtige Familiensaga auf den Kern zu konzentrieren und daraus ein höchst bühnenwirksames Stück zu formen, das die brillante Sprache und die satirische Schärfe Thomas Manns genau wiedergibt. Der komplexe Stoff ist auf das Schicksal der zentralen Figuren verdichtet – Lebensgeschichten, in denen sich das Drama des nur am Handel orientierten Bürgertums spiegelt und die bis heute Millionen Leser gefesselt haben.
Bei den Buddenbrooks steht das Geschäft an erster Stelle. Die Familie ist die Firma und die Firma ist die Familie. Alles ist dem Diktat der Gewinnmaximierung unterworfen, selbst die Wahl der Lebenspartner. Zwar ist die Kaufmannsfamilie wohlsituiert, aber nicht reich genug, um das Vermögen in eine neue, wirtschaftlich härtere Zeit hinüberzuretten. Nach dem Tod des Vaters führt Thomas, der Älteste, das Traditionsunternehmen fort und strebt eine politische Karriere an. Christian hingegen interessiert sich mehr für das angenehme Leben als für kaufmännischen Fleiß. Und die lebenslustige Tony leidet unter den Zwängen des Großbürgertums – ihre gescheiterten Ehen mit dem Bankrotteur Grünlich
und dem bayerischen Exoten Permaneder schaden dem Ansehen der Familie.
Der Niedergang der einst vermögenden und einflussreichen Buddenbrooks ist unaufhaltsam.
Das in der Elterngeneration scheinbar noch intakte Wertesystem der Familie
wird den Nachkommen zum Verhängnis.
Diese Geschichte von gestern ist eine Geschichte von heute.
Denn die Gesellschaft von heute ist eine Gesellschaft von gestern.
Besetzung
|
|
|
|
| Konsul |
Anton Schieffer |
|
|
| Konsulin |
Doris Dubiel |
|
|
| Thomas |
Paul Kaiser |
|
|
| Christian |
Roman Blumenschein |
|
|
| Tony |
Nikola Norgauer |
|
|
| Gerda, Thomas Frau |
Anna Dörnte |
|
|
| Hanno, ihr Sohn |
NN |
|
|
| Grünlich |
Hubert Schedlbauer |
|
|
| Kesselmeyer, Bankier |
Oliver Severin |
|
|
| Permaneder |
Michael Morgenstern |
|
|
| Morten |
Markus Boniberger |
|
|
| Der Leutnant |
Markus Boniberger |
|
|
| Lina, eine Bediente |
Anna Dörnte |
|
|
|
 |
Vom Theater Regensburg aktualisierte Fassung
|
Wer hat sie nicht gelesen, wer liebt sie nicht, die Buddenbrooks, die kesse Tony, die auf Druck ihres Vaters den verhassten Hamburger Geschäftsmann Grünlich heiratet und dabei Schiffbruch erleidet, oder das ungleiche Brüderpaar Thomas und Christian, ersterer ein strebsamer Kaufmannssohn, der in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters tritt und die Familienfirma übernimmt, letzterer ein glückloser Hallodri und Hypochonder. Thomas Manns Jahrhundertroman enthält wunderbare Charaktere und dramatische Konflikte. Es ist eine spannende Geschichte vom Kaufen und Verkaufen. Die Buddenbrooks sind nicht nur eine Familie, sondern auch ein Unternehmen, und das kaufmännische Denken bestimmt sowohl Berufs- wie Privatleben. Wie in kaum einem anderen Text der Weltliteratur klafft hier der tiefe Widerspruch zwischen dem lebendigen, ausufernden Organismus Familie und dem einschneidenden Diktat der Ökonomie –
ein Widerspruch, an dem die Familie Buddenbrook zerbricht.
John von Düffel gelingt es in seiner umjubelten Theaterfassung, die zentralen Motive und den inhaltlichen Kern der großen Familiensaga zu fassen und zu einem kompakten Drama zu formen. Die großen Charaktere der Buddenbrooks sind prachtvolle Bühnenfiguren – in denen sich in Zeiten der ständig kriselnden Wirtschaft viele heutige Menschen wiedererkennen werden.
"Buddenbrooks" ist eine genaue Untersuchung bürgerlicher Werte, ihrer Leistungs- und Lebensfähigkeit. Wann war die Geschichte dieses ökonomischen Überlebenskampfes und seiner menschlichen Opfer aktueller als jetzt?
| Besetzung |
|
|
|
| Konsul |
Anton Schieffer |
|
|
| Konsulin |
Doris Dubiel |
|
|
| Thomas |
Paul Kaiser |
|
|
| Christian |
Roman Blumenschein |
|
|
| Tony |
Nikola Norgauer |
|
|
| Gerda, Thomas` Frau |
Anna Dörnte |
|
|
| Hanno, ihr Sohn |
Moritz Schnell / Sebastian Karl |
|
|
| Grünlich |
Hubert Schedlbauer |
|
|
| Kesselmeyer, Bankier |
Oliver Severin |
|
|
| Permaneder |
Michael Morgenstern |
|
|
| Morten |
Markus Boniberger |
|
|
| Der Leutnant |
Markus Boniberger |
|
|
| Lina, eine Bediente |
Anna Dörnte |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Am 13.
Dezember
2005 fand im
Thalia
Theater
Hamburg die
Uraufführung
des
Schauspiels
'Buddenbrooks'
statt. Die
Dramatisierung
des Roman
von Thomas
Mann geht
auf eine
Idee des
Regisseurs
Stephan
Kimmig
zurück.
Der
Dramaturg
des Thalia
Theaters
Hamburg,
John von
Düffel, 1966
in Göttingen
geboren,
brachte
1998, nach
dem Studium
der
Philosophie,
seinen
ersten Roman
'Vom Wasser'
heraus, dem
weitere
folgen wie
im Jahre
2000
'Schwimmen.
Kleine
Philosophie
der
Passionen',
2001 der
Roman 'Ego'
und 2007
'Beste
Jahre'.
Die
Literaturkritik
setzt sich
intensiv mit
ihm
auseinander.
 Familie
Deutschland
im Ruin Familie
Deutschland
im Ruin
DER
SPIEGEL - 05.12.2005
Mangels
aufregender
neuer Stücke
bringen
Regisseure
derzeit gern
Romanstoffe
auf die
Bühne. In
Hamburg nun
sogar Thomas
Manns als
Heiligtum
verehrte
"Buddenbrooks".
Der
schlimmste
Abgrund der
Verworfenheit
tut sich für
den
rechtschaffenen
Lübecker.
 Schweigen
der Männer Schweigen
der Männer
DER
SPIEGEL - 18.10.2004
John von
Düffel:
"Houwelandt".
Jorge
schwimmt
aufs Meer
hinaus,
immer tiefer
hinein in
"sich selbst
überschattendes
Blau".
Thomas
verzweifelt
an seinem
"sich selbst
lähmenden
Perfektionismus".
 DIE
ANGST VOR
DER
FAMILIENFEIER DIE
ANGST VOR
DER
FAMILIENFEIER
SPIEGEL
special - 28.09.2004
Die
Geschichte
eines in
sich
zerrissenen
Clans
entfaltet
John von
Düffel in
seinem
psychologisch
subtilen
Roman
"Houwelandt".
Eine Familie
kann
unbehelligt
dahinleben,
solange ihre
Mitglieder
einander
nicht
begegnen.
 Zug
um Zug Zug
um Zug
KulturSPIEGEL - 30.08.2004
Der
Schriftsteller
John von
Düffel
springt ins
kalte
Wasser, wenn
er mal nicht
weiterweiß.
Er sagt,
er sei viel
geschwommen
während der
Arbeit an
diesem
Roman. Drei
Jahre lang,
möglichst
täglich,
dreieinhalb
chlorblaue
Kilometer.
|

|
In das
Zentrum
seiner
Bearbeitung
des
Buddenbrooks-Romans
- für die
zwei Jahre
benötigt
wurden -
stellt John
von Düffel
drei Kinder
des Senators
Jean
Buddenbrook:
Thomas,
Christian
und Antonie
- Clara
findet keine
Erwähnung.
Sie haben
das Erbe der
Familie und
das der
Firma zu
tragen und
scheitern
alle,
bedingt
durch
wirtschaftliche
Veränderungen
am Markt,
mehr noch an
den eigenen
Unfähigkeiten,
mit diesem
Markt und
Konkurrenten
fertigzuwerden.
Bei einer
Dramatisierung
eines
Romans, der
in der
Erstausgabe
mehr als
1000 Seien
umfasste,
müssen für
das Theater
Abstriche,
Straffungen
vorgenommen
werden. Bei
der
Verfilmung
des Stoffes,
die
inzwischen
zum vierten
Mal
erfolgte,
können über
Atmosphärisches
Verdichtungen
erreicht
werden.
Auf
Regieanweisungen,
Requisiten
oder
Bühnenbildvorgaben
wird
weitgehend
verzichtet
und damit
den
Darstellern
die
Möglichkeit
gegeben, der
Gestaltung
der Figuren
einen weiten
Raum zu
lassen.
Thomas Mann
nutzt in
seinen
Buddenbrooks
ausgeschriebene
Dialoge wie
z.B. im
Gespräch von
Thomas mit
seiner
Mutter
Elisabeth
wegen der
Vergabe von
Geldern an
die Kirche.
Rede und
Gegenrede
wechseln
sich ab -
eine Vorgabe
für die
Dramatisierung
-
Herauslösung
der Sprache
aus der
romanhaften
Schilderung.
|
|
|

|
Als die Idee einer erneuten
Bearbeitung des Romans für das
Theater bekannt wurde, gab es
Skeptiker, die auf das Malheur
am Theater Basel im Jahr 1976
wie auch auf die Verfilmungen
verwiesen - ob man es nicht
dabei belassen sollte.
Dieser Buddenbrook-Stoff bietet
mit seiner Durchdringung von
wirtschaftlichen Problemen in
einer Zeit gesellschaftlicher
Veränderungen mit den
Schwierigkeiten von Menschen in
ihrer persönlichen Entwicklung
Möglichkeiten, die Situation in
ein Heute zu übertragen, ohne
die historische Basis des
Werkes, eines Zeitraumes von
1835 bis 1877 aus den Augen zu
verlieren und einfach nur zu
aktualisieren.
Die ständige Angst der drei
jungen
'von-Düffel-Buddenbrooks', die
Kontrolle in jeder Hinsicht - ob
im geschäftlichen eines
Familienunternehmens wie auch im
gesellschaftlich/privaten
Bereich - zu verlieren, lässt
sich heute noch mehr
nachzuvollziehen als zum
Zeitpunkt der Schaffung der
Bearbeitung von 2003 bis 2005.
Es fehlen allerdings heute
weitgehend die Zwänge, denen die
Gesellschaft im 19. Jahrhundert
bis hinein in die ersten Jahre
des 20. Jahrhunderts zum Teil
sich selbst auferlegter Drangsal
wie standesgemäße Heirat mit
Übergabe einer Mitgift,
Rückfragen beim Vater, dem
Bruder oder sonstigem Vormund,
um, wie in allen Fällen des
täglichen Lebens, Contenance zu
bewahren.
Ein völlig neues Stück passend
zur Situation zu schreiben, wäre
angebracht, aber es gäbe für die
Dramatisierung keine 'Stütze'
über den Wiedererkennungseffekt,
unter dem Aspekt: die heutige
Gesellschaft ist mit dem Roman
vertraut.
Ansonsten erlaubt die
Bearbeitung für das Theater, das
Publikum an den Roman
heranzuführen und aufzuzeigen,
dass sich die wirtschaftliche
wie auch die gesellschaftliche
Situation im 19. Jahrhunderts in
der heutigen widerspiegelt.
Auch die neue szenische Fassung
- nach der von 1976 durch Tadeus
Pfeifer - birgt die Gefahr des
Scheiterns, wenn dem Publikum
nicht aufgezeigt werden kann,
dass Elementares vermittelt
werden soll und wird, wobei die
Besetzung der Rollen von
spezieller Wichtigkeit ist.
Über das Talent der Darsteller
und die Regieführung muss die
Situation der Menschen in der
damaligen Zeit aufgezeigt
werden:
'... von jungen Mädchen
findet man's
entsetzlich, wenn sie
ein Selbst sein wollen,
sie dürfen überhaupt
nichts sein, im besten
Fall eine
Wohnstubendekoration
oder ein brauchbares
haustier, von tausend
lächerlichen Vorurteilen
eingeengt.
die geistige Ausbildung
wird vollständig
vernachlässigt.'
(Franziska Gräfin
Reventlow, Tagebücher
1895-1910, Fischer tb,
1976, S. 12)
|
Und die große deutsche
Schauspielerin Tilla Durieux
schrieb:
|
'Ein junges Mädchen
durfte wohl malen,
Klavier spielen, singen,
nur Gott behüte nicht
mit künstlerischem
Anspruch. Sie hatte auf
den Mann zu warten, dem
sie, liebend oder nicht,
beglückt in eine ehe
folgte, der dann wieder
solche 'Wartemädchen'
entsprangen, die dann
wieder .... und so fort
in alle Ewigkeit.'
(Tilla Durieux, Meine
ersten neunzig Jahre,
rororo tb, 1976, S. 16)
|
|
|

|
Die Inszenierung der
'von-Düffel-Buddenbrooks' am
Theater Regensburg gibt dem
Publikum mehr als nur ein Rätsel
auf.
Kennt es den 'Thomas-Mann-Roman'
nicht, ist ihm von vornherein
die Basis für die
von-Düffel-Bearbeitung entzogen
und es tappt von Auftritt zu
Auftritt, ohne im Moment des
Verarbeitens einen Bezug zu
bereits Gesehenem herstellen zu
können.
Tony - Nikola Norgauer
und Thomas - Paul Kaiser
suchen mit Taschenlampen
leuchtend zwischen vom
Schnürboden dräuend
herabhängenden
Geld-/Getreide-/Pfeffer-/Säcken,
finden an der Rampe das
Familienbuch der Buddenbrooks
und stottern herum, als sie
'geb.' nicht definieren können
und ihnen das Wort 'Police' auch
fremd ist.
Szenenwechsel
Kanne mit schepperndem Deckel
wird an der Familie Buddenbrook
vorbei, die wie Hühner auf einer
Stange aufgereiht sitzen
von der hier stummen und
gramgebeugten Hauswirtschafterin
Nina - Anna Dörnte
getragen, die Konsulin nimmt den
klappernden Deckel der Kanne ab
und erhält etwas in ein Gefäß
eingeschüttet.
Sie beklagt sich über
Personalmangel "wenn
ich an das Personal meine Eltern
denke", der Konsul
schildert nebenbei Zeitung
lesend die Lage des
Unternehmens, dessen finanzielle
Ausstattung immer mehr abnehme.
Während des "wir
sind nicht so ungemein reich"
des Konsuls legt Tony den Kopf
auf die Schulter des neben ihr
sitzenden Bruders Christian -
Roman Blumenschein, sie
zaust ihre eigenen Haare, wird
von der Konsulin gemaßregelt,
ihre Haltung sei nicht "comme
il faut".
Nina / Anna Dörnte bringt
dem Konsul auf einem Tablett
eine Visitenkarte:
'Grünlich, Agent - ein
angenehmer, gut empfohlener
Mann' -
Auftritt Bendix Grünlich -
Hubert Schedlbauer - er mimt
einen sich in permanenter
Exaltation befindlichen, in
jeder Hinsicht Behinderten, der
mittels einer Digitalkamera mit
Elektronenblitz die Familie
Buddenbrook ablichtet.
Welch genialer Brückenschlag des
Regisseurs Johannes Zametzer von
der Mitte des 19. Jahrhunderts
in die Gegenwart. Diese Schiene
passt zum krampfhaften
Verheutigen des 'Onegin',
ebenfalls am Theater Regensburg
als dort U-Bahn-Züge im
Hintergrund mittels Projektion
gezeigt werden.
Und auch im 'Ritorno d'Ulisse'
werden Laptops und ein Handy
gezeigt, zur Verwunderung selbst
der Darsteller.
So rennt das Theater Regensburg
einem Trend hinterher,
Baden-Baden ist dem nie gefolt,
aber den Regensburgern kann man
das Altbackene ja noch anbieten
- 'passt scho!'.
Anna Dörnte / Nina nimmt
der Konsulin die Tasse ab, ehe
Herr Grünlich/Hubert
Schedlbauer - ins Publikum
starrend - fortfährt:
"Oh, was
für ein reizender Garten"
- um sich dann über die
Lektüre der Buddenbrooks-Kinder,
Hoffmanns Serapionsbrüder und
Cicero auszulassen. Dem Konsul
wäre es lieber, sein Nachwuchs
bereitete sich mehr auf das
praktische Leben vor.
Grünlich/Hubert Schedlbauer
Tony ablichtend und der Konsulin
das Bild auf dem Display
zeigend: 'Beachten
sie wie die Sonne im Haar ihrer
Tochter spielt' -
Tony verstrubbelt dieses
daraufhin ostentativ.
Während die Konsulin den
Grünlich/Hubert Schedlbauer,
nach dessen Abgang in Begleitung
des Konsuls als angenehmen Mann
empfindet, meint Tony, er sei
albern. Und Christian äfft
Grünlich/Hubert Schedlbauer
zur Freude des Publikums nach.
Paul Kaiser tritt als
Thomas an die Rampe und tönt ins
Publikum, er müsse an seinem
Platz sein, er könne früh
berufen werden. Wenn er gut
leben wolle, müsse er hart
arbeiten, härter noch als
andere. Er müsse Härte erleiden
und nicht als Härte empfinden.
Der Konsul fragt die auf einem
'Schammerl' in Bühnenmitte
hockende Tony, dass man Grünlich
doch als braven und
liebenswürdigen Mann
kennengelernt habe, der um die
Hand der Buddenbrooks-Tochter
bitte, was sie davon halte.
Tony: sie verstehe nicht, was
Grünlich von ihr wolle,
schließlich habe sie ihm nichts
getan.
Mutter Konsulin eilt zur
erstaunt um sich blickenden
Tochter und erklärt ihr,
Grünlich sei schließlich eine
gute Partie, außerdem böte sich
ihr diese Gelegenheit, ihr Glück
zu machen, nicht alle Tage.
Tony hält dagegen, sie könne
Grünlich nicht ausstehen, sie
werde zur Heirat nie ihr Ja-Wort
geben.
Szenenwechsel
Thomas / Paul Kaiser
tritt - sich eine Krawatte
bindend nach vorne und fragt ins
Publikum nach der Definition des
Begriffes 'Erfolg'. Da er vom
Auditorium keine Antwort
erhält, schließt er mit:
"Ich
muss bereit sein"
und geht ab.
Tony / Nikola Norgauer
hampelt auf ihrem
Kinderschammerl zu eingespielter
spanischer Instrumentalmusik
herum und singt
"Dibit,
dibit, dibit"
während die Säcke vom
Schnürboden heruntergefahren
werden, unter denen sich
Grünlich/Hubert Schedlbauer
mit Video-Kamera auf einem
Stativ hervorwälzt. Ihn habe der
Brief, den er vom Konsul
bezüglich einer Eheschließung
mit Tony / Nikola Norgauer
erhalten habe, mit Hoffnung
erfüllt.
Er
erwarte von Tony das Wort zu
hören, dass ihn glücklicher
machen werde, als er es zu sagen
wage - in die aufgestellte
Kamera kommt ihr 'Nein'.
Man kann es verstehen, dass sie
dieses hysterische Mannsbild
nicht will und mehrfach betont
sie es durch ein unzweideutiges
'Na-hein',
auch wenn sich Grünlich/Hubert
Schedlbauer nun auf ein
freies Kinderschammerl stellt
und Flugübungen zu machen
versucht, indem er die Arme zum
Abheben wie Flügel ausbreitet
und dies dabei noch auf einem
Bein balancierend. (Kommentar
des Betrachters: 'Dämlicher
geht's nicht!' - aber Grünlich
ist eben so und Hubert
Schedlbauer geniert sich nicht,
den Bewerber um die Hand der
Tony geradezu zum Affen zu
machen. Zuschauer entsprechend
happy.)
Grünlich erhält von Tony ein
erneutes 'Na-hein',
er faltet leichtfertig die Arme
zusammen, der sich gerade
aufbauende Auftrieb nimmt bis
zum 'stall', dem
Strömungsabriss, rapide ab und
der Werber stürzt vom Schammerl
auf den harten Bühnenboden der
Tatsachen.
Die Säckesammlung fährt nach
oben in den Schnürboden,
Grünlich geht mit der Drohung,
dass er zurückkehren werde,
durch die Mitte ab.
Szenenwechsel
Christian / Roman
Blumenschein schreitet über
die Bühne.
Konsul / Anton Schieffer
und Kosulin / Doris Dubiel
nehmen auf Stühlen mitten auf
der Bühne Platz und überlegen,
warum Tony den Grünlich wohl
nicht wolle.
Von hinten aus der Mitte naht
die offensichtlich unter
Osteoporose leidende Nina /
Anna Dörnte mit einem
Tablett, darauf Gefäße, die von
denen, denen sie dargeboten
werden, geleert werden. Die
herumstehenden Kinderschammerl
nimmt sie nach hinten mit, in
die Kulisse.
Tony / Nikola Norgauer
werde sich schon an Grünlich /
Hubert Schedlbauer
gewöhnen, meinen ihre
Konsul-Eltern, außerdem habe der
Konsul / Anton Schieffer
die Bücher des Bewerbers
Grünlich gelesen, sie seien zum
Einrahmen, sein Vermögen belaufe
sich auf 100.000 und die
Auskünfte aus Hamburg seien
außerordentlich
zufriedenstellend, daher könne
er diese Heirat nur dringend
erwünschen, betont er. Die
80.000 für Tonys Mitgift seien
sehr gut angelegt.
Die Konsulin / Doris Dubiel
bemerkt, man dürfe die Tochter
nicht malträtieren, sie müsse
sich besinnen, dann werde sie
schon zur Vernunft kommen.
Szenenwechsel
Vom Band ertönt
Brandungsrauschen - der gemeine
Regensburger wähnt auf diese
Weise, am Meer zu sein - dem
Original entsprechend wäre es
Travemünde - ein aufreizend gut
gewachsener Jüngling, Morten /
Markus Boniberger, strömt
in Badehose mit Badetuch von
links, von rechts trippelt Tony
/ Nikola Norgauer
badebekleidet auf die Szene. Ihr
Tuch legt sie ordentlich aus,
zieht es gerade, streckt dabei
ihr Hinterteil dem Publikum
entgegen.
Ein Dampfer tutet, Morten /
Markus Boniberger gibt auf
Befragen von Tony / Nikola
Norgauer bekannt, dass es
sich hier um ein Schiff namens
'Albatros' handele, das nach
Russland fahre.
Auf Tonys Frage, was er gerade
lese, verkündet er, ein Buch
über das Lungenödem und wie er
mit Vornamen heiße, beantwortet
er mit dem Hinweis, sein
Großvater sei ein halber
Norweger gewesen, der Morten
geheißen habe, deswegen sei sein
Vorname gleichlautend mit dem
des Großvaters, während ihm Tony
/ Nikola Norgauer zur
Abwehr aggressiver
Sonnenstrahlen und zur
Vermeidung eines Sonnenbrandes
den Rücken einkremt und das
mitten im 19. Jahrhundert oder
ist das schon ins 21.
transferiert.
Sie klärt Morten darüber auf,
wer Grünlich ist und dass sie
ihn zurückgewiesen habe,
währenddessen sie auf Mortens
Gesäß rittlings sitzend
herumhopst. Folgen dieser
rhythmischen Bewegungen sind bei
Morten nach dessen Aufstehen
nicht erkennbar.
Plötzlich ein Zwischenton, sie
mache sich nicht immer lustig
über Leute, die ihr zu Füßen
lägen, das dürfe man nicht von
ihr denken - womit Morten
gemeint sein muss. Sie habe ihn
sehr gern. Das zu bekräftigen
gehen beide nach links hinten
ab, wohl in den Strandhafer -
die Badetücher bleiben liegen.
Szenenwechsel
Thomas / Paul Kaiser
brüllt von hinten aus der Mitte
kommend nach einer Anna - wohl
weit über die Trave, hier nur
ins Publikum. Dieses steht vor
der ungeklärten Frage: Wer bitte
schön ist Anna?
Der Eingeweihte weiß natürlich,
dass es sich um die
Blumenhändlerin Anna handelt,
mit der Thomas seit langer Zeit
ein erotisches Verhältnis hat.
Sie solle vernünftig sein und
nicht weinen und sich nicht
wegwerfen, was sie bisher nicht
getan habe, fordert er sie
lauthals im Abgehen aus der
Tiefe der Bühne auf. Diese
Aussage münzt er auf sich
selber. Er werde in Amsterdam
erwartet und schreibe ihr,
sobald er dort sei. Sie werde
schon eine andere gute Partie
machen.
Lachend Morten / Markus
Boniberger und Tony /
Nikola Norgauer tropfnass
von links hinten -
offensichtlich waren sie nach
dem vom Publikum vermuteten
Strandhafer-Aufenthalt zur
Abkühlung im Meer. Sie gibt ihm
einen Brief von Grünlich, in dem
sich ein Ring für die angebetete
Tony befindet, den sie aber
zurück schicken lassen werde.
(Aus der Kulisse rechts filmt
ein Spanner - es muss Grünlich
sein.)
Szenenwechsel
Konsul / Anton Schieffer
liest Konsulin / Doris Dubiel
seinen Brief an Tochter Tony
vor, mit dem er ihr klar macht,
sie sei nicht allein, sondern
innerhalb der Familie ein Glied
in einer Kette. Dies alles möge
sie bei ihrer Entscheidung
bezüglich Grünlich bedenken.
Szenenwechsel
Christian / Roman
Blumenschein tobt zu
Disko-Musik nur mit hellen Jeans
und Rotfuchsmantel o.ä. über dem
sonst nackten Body auf die Bühne
und behauptet, alle seien in
London - Projektionen auf die
helle Bühnenrückwand zeigen
hopsende Menschen - dies wohl
in Anlehnung an den 'That's
Maria-Song' aus der zweiten
Buddenbrook-Verfilmung.
Er, der junge Buddenbrook, außer
Rand und Band, der Türsteher
zieht ihn in die Disco.
Szenenwechsel
Tony / Nikola Norgauer
hockt an der Rampe und gibt dem
Publikum die Erläuterung, sie
folge den Vorgaben des Vaters,
der ihr brieflich die Sache mit
dem Glied in der Kette einer
Familie mitgeteilt habe und sie
sich füge sich, "an
der Geschichte meiner Familie
mitzuarbeiten".
Szenenwechsel
Konsul / Anton Schieffer
liest für die Konsulin /
Doris Dubiel aus seinem
Brief an Sohn Thomas, er sei
erfreut über des Sohnes Erfolge
in Amsterdam, er möge aber nur
solche Geschäfte am Tage machen,
nach denen man auch in der Nacht
ruhig schlafen könne. Leider
gäbe es nun Leute, die ohne
diese Prinzipien besser führen
wie der Hagenström, an den er
gerade denke, dessen Geschäfte
intensiv im Wachsen begriffen
seien.
Schmunzelnd die Mahnung an die
Konsulin gerichtet, deren
Familie möge die Groschen besser
zusammenhalten.
Szenenwechsel
Grünlich tritt normal gehend,
nicht wie in seinem ersten
Auftritt hampelnd, aber dafür
kauend mit einem Teller in der
Hand, einer Serviette umgebunden
von links auf, Tony eilt von
rechts herbei, die letzten
Tropfen aus einer mitgeführten
Tasse trinkend. Auf den Vorwurf
des Gatten, sie sei nicht
kinderlieb, schnippst sie ihm
Essen vom Teller (tolle Zustände
in dem Haushalt, empfindet das
Regensburger Publikum) sie sei
schließlich mit Hauswirtschaft
beschäftigt. Sie stünde morgens
mit 20 Vorhaben auf und ginge
abends mit 40 zu Bett, somit
müsse trotz der zwei
Haushaltshilfen, ein
Kindermädchen eingestellt
werden. Zur Krönung der
Darstellung ihrer Missbilligung
legt Tony / Nikola Norgauer
ihrem Gatten das Kotelett auf
den nackten Kopf. Ihr reicher
Vater habe nicht ahnen können,
dass es ihr jemals an Personal
werde mangeln können, wobei sie
die Tasse mit Untertasse zu
Boden fallen lässt.
Grandios wie Nikola Norgauer
den ungezogenen Balg spielt, der
doch eine so gute Erziehung
genossen hat. Unmöglich für
Grünlich/Hubert Schedlbauer
hier mithalten zu können, wenn
er auch seinen Teller der Tasse
seiner Tony / Nikola Norgauer
hinterher wirft. Das Porzellan
zerschellt am Boden und bleibt
für restlichen Szenen bis zur
Pause dort liegen.
Auftritt Bankier Kesselmeyer /
Oliver Severin, der einen
scheppernden Wecker aus der
Kulisse in diese Szene hält,
für das Publikum nun deutlich
erkennbar: 'Buden'-brooks'
- der Name dieser Produktion.
Der Bankier gibt Tony recht,
nicht sie ruiniere Grünlich,
denn er sei es bereits. An eine
Prolongation der
Verbindlichkeiten durch die
Banken sei nicht zu denken.
Bankier Kesselmeyer / Oliver
Severin entzündet ein
Streichholz an Grünlich /
Hubert Schedlbauers Glatze,
reicht ihm die Flamme zum
Anrauchen einer Zigarre und
löscht genüsslich durch
Ausblasen das Feuer am Holz.
Nachdem Grünlichs finanzieller
Unterstützer (Konsul Buddenbrook
d. Redaktion) auch wackle, müsse
er, Kesselmeyer / Oliver
Severin, Papiere verkaufen
und sein Kapital fordern. Sein
Blick in seinen modernen - von
innen rot illuminierten -
Aktenkoffer zeigt ihm wohl die
aktuellen Kursverläufe an.
Kredite werde er dem an der in
seinem Mund befindlichen Zigarre
vorbeischwafelnden Grünlich/Schedlbauer
nicht gewähren.
Nun werde es eben "ein
höchst spaßhaftes Bankröttchen"
geben.
Szenenwechsel
Thomas / Paul Kaiser
bespricht monologisierend die
Lage des Unternehmens - geht
nach links ab, sich selbst
bestätigend, man müsse sich für
die Firma aufreiben, wer täte
das nicht.
Konsul / Anton Schieffer
aus der Mitte, für Tony /
Nikola Norgauer
überraschend, die von rechts
herbeikommt. Sie ist über Vaters
Erscheinen erfreut, er aber sei
zu einer sehr, sehr ernsten
Unterredung mit ihrem Mann
gekommen und wolle garnicht erst
ablegen.
Mit großem Getue und
pathetischem Gestikulieren
berichtet Tony ihrem Vater,
Grünlich habe gestern mehrfach
gefragt, ob sie ihn liebe und ob
sie für ihn ein gutes Wort beim
Vater einlegen wolle.
Für das Publikum völlig
unverständlich, tobt Nikola
Norgauer als Tony voller Freude
über die Bühne als sie vom Vater
hört, dass ihr Mann Grünlich
Bankrott anmelden müsse.
Er, Vater Buddenbrook, bereue
die damalige Entscheidung, seine
Tochter zur Ehe mit Grünlich
gedrängt zu haben. Auf die
Frage, ob sie Grünlich in den
vier Jahren lieben gelernt habe,
verneint Tony dies, sie habe den
nie geliebt.
Wie Nikola Norgauer diese
Szene spielt, lässt den Schluss
zu: sie hat im Laufe des Abends
ganz eindeutig die Grünlich'sche
Exaltation aus dessen erster
Szene übernommen - dies zur
Freude des Publikums.
Konsul / Anton Schieffer
bietet an, Grünlich zu retten,
aber Tony will lieber zu den
Eltern zurück nach Lübeck, als
dass durch die Abdeckung der
Schulden Grünlichs durch den
Konsul die Möglichkeiten der
eigenen Firma und der Familie
Buddenbrook eingeschränkt
würden. In dem Moment segelt
Grünlich herein, begrüßt
überschwänglich den Konsul, der
seinerseits Tochter Tony zu
deren Tochter Erika wegschickt.
Bankier Kesselmeyer / Oliver
Severin schwingt sich auf
die Bühne und freut sich, die
Ehre zu haben, den Konsul zu
sehen. Die Prüfung der Bücher
durch den Konsul werde ergeben,
dass es sich bei ihm, Grünlich,
um einen Unglücklichen, nicht
aber um einen Schuldigen handele
- meint Grünlich / Hubert
Schedlbauer, der auf Knien
um Hilfe fleht und androht, sich
sonst mit eigener Hand zu töten,
falls ihm die 120.000
Schwiegerväterlicher Kredit
nicht gewährt würden.
Kesselmeyer / Oliver Severin
klärt auf wie seinerzeit durch
die Heirat Grünlichs mit Tony
und die Mitgift von 80.000
dessen Firma gerettet werden
konnte, von denen 3/4
Wechselschulden abdeckten. Alle
Erkundigungen des Konsuls über
die Bonität Grünlichs seien
'getürkt' gewesen, da die
Gläubiger wussten, auf diesem
Wege zu ihren Geldern zu kommen.
Tony / Nikola Norgauer
kommt von rechts in Hut und
Mantel mit Koffern, ihr
Unbehaustsein verdeutlichend. Da
sie Grünlichs / Hubert
Schedlbauer Flehen, zu
bleiben, nicht erhört, nimmt er
ihr wütend die Koffer ab und
wirft diese schwungvoll - da
leer - links in die Kulisse,
schließlich sei er ihrer
überdrüssig, schreit er ihr
hysterisch ausflippend nach.
Der Konsul gibt Grünlich im
Abgehen den Rat, sich zu fassen
und zu beten. Unter diabolischem
Lachen folgt Bankier Kesselmeyer
/ Oliver Severin dem
Konsul.
Das Publikum ist amüsiert.
Szenenwechsel
Konsulin / Doris Dubiel,
Thomas / Paul Kaiser und
Tony / Nikola Norgauer
warten auf das Erscheinen des
Konsuls. Aber der käme ja immer
zu spät, da er so viel zu
erledigen habe. Immer hetze er
sich, nähme mehrere Stufen auf
einmal und so sei es kein
Wunder, dass es ihm dann nicht
gut gehe.
Es könne einen Regenguss geben,
aber nichts von Dauer ist die
meteorologische Voraussage von
Thomas. Der Spaziergang müsse
eben nach dem Gewitter
durchgeführt werden.
Die Szene wird abgedunkelt -
eine Stimme aus dem Off teilt
mit:
es sei da plötzlich dieser
Moment eingekommen, es habe sich
etwas Lautloses, Erschreckendes
ereignet. Das Regenwasser habe
im Rinnstein geschäumt und sei
auf den Bürgersteig hoch
emporgesprungen.
Da stürzt aus der Mitte die
hastig norddeutschplatt
plappernde, in Kapuzenmantel
gehüllte, Nina herein und
verkündet, der Konsul sei soeben
verstorben.
Alle schnell ab.
Christian / Roman
Blumenschein kommt in Hut
und Mantel mit Gepäck von links,
stolpert in der Mitte der Bühne
über seine eigenen Beine, fällt
hin, hebt die Koffer auf und
geht schnell nach rechts ab.
Die von Herrn von Düffel für den
Auftritt Nr. 26 vorgegebene
Regieanweisung:
- Christian mit Gepäck, er
stolpert, tritt gegen einen
Koffer, noch einen Tritt, ein
Tanz wird daraus, eine wütenden,
entfesselte Steppnummer.
Plötzlich bricht er ab -
wird in der Form nicht
ausgeführt, obwohl Roman
Blumenschein das - eingedenk
seiner Szene vor der Disco in
London - sicher gut hinbekommen
hätte.
|
|

|
Unter
vom
Schnürboden
heruntergefahrenen
Säcken
besprechen
Konsulin
/
Doris
Dubiel
mit
Thomas
/
Paul
Kaiser
die
Testamentseröffnung,
Christian
solle
auch
kommen,
sie
habe
ihn
acht
Jahre
nicht
gesehen.
Sie
wolle
alle
um
sich
haben
in
dieser
schweren
Zeit.
Und
wo
sei
Christian
besser
aufgehoben
als
im
Geschäft
seines
seligen
Vaters,
weist
sie
frohlockend
ihren
Sohn
Thomas
an.
Dass
im
Stück
Konsul
Buddenbrook
gestorben
ist,
merkt
man
Doris
Dubiel
in
der
Darstellung
der
Witwe
nicht
an,
sie
ist
locker
drauf
wie
weiland
'Frau
Pinneberg'
-
trägt
nur
eine
dunkle
Brille,
die
Trauer
den
Regensburgern
gegenüber
dokumentierend.
Ansonsten,
noch
nie
wie
hier:
Elegance
par
excellence.
Thomas
macht
gegenüber
der
Konsulin
- im
Beisein
von
Tony,
die
von
rechts
herbeigeeilt
ist,
einen
Kassensturz:
Tonys
Mitgift
sei
verloren
gegangen
-
das
Vermögen
belaufe
sich
auf
750.000
-
eigentlich
müsste
man
längst
ein
Million
erreicht
haben.
"Aber
die
Zersplitterung."
Thomas
entschuldigt
sich
dafür,
nun
nur
über
die
Firma
und
nicht
über
die
Familie
zu
sprechen.
"Hunderttausende,
die
dem
Betrieb
entzogen
werden."
Szenenwechsel
Christian
/
Roman
Blumenschein
mit
zwei
Koffern,
diese
in
der
Mitte
abstellend,
fragt
seine
Schwester
Tony
/
Nikola
Norgauer
in
einer
unglaublich
albernen
und
der
Situation
nicht
angepassten
Art
und
Weise,
das
letzte
Stöhnen
des
Vaters
nachäffend:
"Also
gelb,
gelb
sah
er
aus
der
Pappa"
- um
gleich
darauf
wissen
zu
wollen,
ob
die
Familie
es
kenne,
"wenn
man
einen
harten
Bissen
verschluckt
und
es
tut
hinten
den
ganzen
Rücken
hinunter
weh?"
|
|
|

Thomas /
Paul Kaiser
kritisiert
gemeinsam
mit der
Konsulin /
Doris
Dubiel,
Christian
(nach dessen
Abgang) ,
dieser sei
nicht in der
Lage, die
Contenance
zu wahren.
Er selber
aber habe
manchmal
auch "über
diese
ängstliche,
eitle und
neugierige
Beschäftigung
mit sich
selber
nachgedacht."
Christian
kommt, er
fragt nach
der so
plötzlichen
Gottesfürchtigkeit
der Mutter.
Seit Vaters
Tod sei sie
so, bekommt
er zur
Antwort.
Thomas
bespricht
mit
Christian
die
gemeinsamen
Tätigkeiten
in der
Firma.
Christian
übergibt
Reisemitbringsel
- u.a. zur
Erheiterung
des
Publikums -
einen
Schrumpfkopf
aus
Valparaiso,
die er einem
Koffer
entnimmt,
den der
unter
Aufwendung
von Gewalt
mit dem Fuß
öffnete.
An der Börse
rede man
über ihn:
Buddenbrook
wolle mit
'avec' Geld
verdienen.
Szenenwechsel
Während
Thomas
hinten die
Bezifferungen
der vom
Schnürboden
heruntergelassenen
Säcke
diktiert,
philosophiert
Christian
vorne über
den
Kaufmannsberuf:
"
... die
Hände fühlen
sich
zufrieden."
Szenenwechsel
Thomas
zitiert aus
einem Brief,
den er an
seine
Mutter, die
Konsulin aus
Amsterdam
schickte. Im
Hintergrund
eine Dame
die Violine
spielend. Er
sei stolz,
dass seine
'gute Partie
Gerda' durch
deren
Mitgift
einen
erheblichen
Kapitalzufluss
ermögliche.
Szenenwechsel
"Da
seid ihr ja"
ruft Tony /
Nikola
Norgauer
juchzend von
rechts,
Thomas /
Paul Kaiser
und Gerda /
Anna
Dörnte
nach deren
Ankunft aus
Amsterdam in
Lübeck
begrüßen zu
können. Die
Konsulin
heißt Gerda
die "liebe,
schöne,
gesegnete
Tochter"
im Haus und
"unserer
Familie"
willkommen.
Christian
kommt auf
einen Stock
gestützt
Gerda
entgegen, er
empfinde
Qualen im
linken Bein.
Kaum
unterhalten
sich Tony
und Gerda
über ihre
gemeinsame
Zeit im
Pensionat,
'quatscht'
Christian
zum
Amusement
des
Publikums
dazwischen:
"es
ist die
ganze linke
Seite, so
ein
unbestimmter
Schmerz",
worauf
ihn Mutter
Konsulin an
die Hand
nimmt und
mit ihm
abgeht.
Tony
beglückwünscht
Thomas zu
der Mitgift
von 300.000
durch die
Heirat von
Gerda: "Das
hast du gut
gemacht"
- auf
die Frage,
von Thomas
an Gerda
gerichtet,
ob sie
Kopfschmerzen
habe, meint
diese: "lass
nur"
und
schreitet
nach links
hinten ab.
Anton
Schieffer
als Konsul -
sein Philipp
II. passt in
sein
Darstellungsschema
- füllt die
Rolle des
auf
Geldzuwachs
bedachten
Kaufmanns
unter
konsequenter
Inkaufnahme,
dass er
seine
Tochter Tony
ins Unglück
stürzt.
Täuschen
ließ er sich
im Falle
Grünlich
allerdings
von
zweifelhaften
Gutachten.
Diese zweite
Seite der
Figur,
geprellt
worden zu
sein, wird
zu wenig
ausgespielt,
ebenfalls
nicht die
Anspannung,
mit der er
zu Werke
geht. So
heißt es im
Text, er
brächte viel
Zeit an
seinem
Schreibtisch
zu, was
darauf
schließen
lässt, dass
er seine
Aufgaben
nicht mit
Souveränität
erledigen
kann. Die
Anspannung,
der Stress
wird nicht
deutlich,
der
schließlich
zu einem
Infarkt
führt.
Die Gerda
von Anna
Dörnte,
die, wie
Tony
feststellt,
schöner
geworden
ist. Der
kritische
Beobachter
sieht Frau
Dörnte noch
immer als
Klara in der
verunglückten
Regensburger
Wüllenweber-Inszenierung
von Hebbels
'Maria
Magdalena'.
 Was
wir dazu
sagen wollen Was
wir dazu
sagen wollen
Passend zur
Figur der
Gerda, der
coole,
abgeklärte,
unaufgeregte
Neuzugang
zur Familie
Buddenbrook,
die alle
mehr oder
minder durch
ihre
Emotionalität
den
Überblick
verlieren
und
letztendlich
zugrunde
gehen.
An erster
Stelle die
aufgeregte,
vornehm
ausgedrückt,
die
temperamentvolle
Tony /
Nikola
Norgauer,
wie kann man
diesen
Grünlich
ehelichen,
hier war
allerdings
Vater und
Konsul die
treibende
Kraft. Bei
der zweiten
Ehe nimmt
sie, um die
Scharte der
ersten
Scheidung
auszuwetzen,
einen
Bayern.
Als wenn das
nun eine
Lösung hätte
sein können.
Und das in
der
damaligen
Zeit, wo es
nur
Lederhose
und keine
Alternative
in Form
eines
Laptops gab.
Außerdem, so
etwas wie
den heutigen
'Horst I. -
Herzog von
Bayern -
genannt der
Zänker', gab
es damals
zuhauf.
Thomas /
Paul Kaiser
treibt seine
Schwester in
die
'Luftveränderung'
- München
ist ihr
Ziel.
Er will für
den Lübecker
Senat
kandidieren,
Gerda werde
eine Rolle
neben ihm in
der Stadt zu
spielen
haben.
|

|
Szenenwechsel
Tony /
Nikola
Norgauer
lässt sich
von der
Soufflage,
die in der
Mitte der
ersten Reihe
Platz
genommen
hat, einen
Hiaslhut
reichen, den
die
'Einflüsterin'
zufällig bei
sich hat,
setzt ihn
auf und
erklärt -
sich immer
wieder über
die Rampe
vorbeugend -
den
Zuschauern,
dass ihr
München und
ein Herr
Permaneder
ausnehmend
gut gefalle,
was wiederum
das
Regensburger
Publikum
hörbar
erfreut.
Szenenwechsel
Christian
traktiert
mit seinem
Spazierstock
die von
Schnürboden
herunterhängenden
Säcke.
Bruder
Thomas hat
nach eigener
Aussage
Christians
wegen großen
Ärger, da
der im Klub
behauptete,
Geschäftsleute
seien
sämtlich
Gauner, was
er im Spaß
gemeint
habe.
Mitbewerber
Hagenström
sei die
Antwort
nicht
schuldig
geblieben,
der hielte
seinen Beruf
als Kaufmann
sehr hoch
und habe
damit - nach
Meinung von
Thomas - der
Familie
Buddenbrook
eins
versetzt.
Und
Christian -
der
verbummelte
Mensch -
mache sich
und vor
allem die
Familie
lächerlich,
er, der
nicht einmal
wisse, was
Arbeit sei,
der sein
Leben
vergeude mit
Gefühlen und
Empfindungen.
Er
kompromittiere
alle, wo er
gehe und
stehe. Er
sei ein Übel
hier in
dieser
Stadt.
Christian
will gehen,
nimmt die
bereitstehenden
Koffer, er,
Thomas
brauche ihn
nicht
rauszuwerfen.
Aber der
hält ihn
zurück, man
müsse sich
in einer
Familie
aussprechen
können.
Thomas
bietet ihm
an, Geld für
einen
Einstieg in
einer
anderen
Firma
bereitzustellen.
Szenenwechsel
Auftritt
Michael
Morgenstern
als Alois
Permaneder
mit einem
Kasten Bier
der
Regensburger
Brauerei
'Bischofshof'
in den
Händen.
Durch die
maßlose
Übertreibung,
mit der Herr
Morgenstern
die Rolle
gestaltet -
mit den
Flaschen im
Bierkasen
klappert,
zum Barwagen
hinüberschnüffelt
- und Frau
Konsulin /
Doris
Dubiel
attackiert,
findet er
freudige
Zustimmung
beim
Regensburger
Publikum,
lässt aber
das Niveau
der
Produktion
weiter
absinken.
So tragen
gerade diese
Szene und
die
Ansprache
von Tony /
Nikola
Norgauer
wie auch das
Gehabe von
Grünlich /
Hubert
Schedlbauer
und Bankier
Kesselmeyer
/ Oliver
Severin
erheblich
dazu bei,
die ganze
Inszenierung
zur Klamotte
werden zu
lassen.
Das haben
weder Thomas
Mann und
John von
Düffel
verdient.
Tony
erkennt den
Gast wieder,
mit dem sie
in München
'a Gaudi
g'habt hat.'
Mutter
Konsulin
kritisiert,
dass der
Mann so
fluche.
Thomas klärt
sie auf:
"Ja,
das ist
Süddeutsch"
-
und bei dem
Ausspruch
'ham die
Rengschburger
wieder a
Freid.'
Man hat
seitens des
Theaters
Regensburg
wohl dem
Affen Zucker
geben
wollen, um
den Zuspruch
der
Bevölkerung
zu erhöhen.
Dass nach
dem Abgang
von
Permaneder /
Michael
Morgenstern
kein
jubelnder
Szenenbeifall
des
Regensburger
Publikums
kommt,
verwundert.
|

|
Tony fragt
Gerda, ob
Permaneder
sie wohl zur
Frau haben
wolle. Er
sei nicht
schön aber
in München
war er so
treuherzig
und
behaglich.
Ja dort,
aber hier im
Norden -
zweifelt
Gerda.
Vielleicht
sollte sie
lieber in
München mit
ihm leben.
Es gehe Tony
weniger um
eine gute
Partie, denn
um das
Auswetzen
der Scharte,
die sie der
Familie, mit
der
Scheidung
von Grünlich
beigebracht
habe.
Szenenwechsel
Thomas ist
zum Senator
gewählt und
schwört den
Eid auf die
Verfassung.
Szenenwechsel
Tony gibt,
jede Phrase
mit
Körpereinsatz
unterstützend,
an der Rampe
Erläuterungen
zu den
Unterschieden
der
deutschen
Sprache in
Bayern und
in Lübeck.
Permaneder
nenne sie "Tonerl"
und ihm "war's
g'nua".
Szenenwechsel
Thomas
schiebt
einen
Kinderwagen
herein, mit
seinem Sohn
'Hanno,
Johann,
Justus,
Kaspar', dem
Erben, dem
Stammhalter,
der die
Geburt nur
schwer
überstanden
habe.
Christian
bringt für
das Kind ein
Riesen-Kuscheltier.
Seine Nerven
auf der
linken Seite
seien zu
kurz, er
schlafe
nicht ein,
da er Angst
habe, sein
Herz höre
auf, zu
schlagen.
Seinen
Bruder
Thomas klärt
er auf, das
dritte Kind
der Aline
Puvogel, das
kleine
Mädchen, sei
von ihm. Er
werde
Hamburg als
Selbstständiger
abschließen
und als
Angestellter
nach London
gehen.
Gerda durch
die Mitte,
reicht
Thomas einen
Brief, der
soeben
gekommen
sei. Tony
schreibt, in
München sei
alles sei zu
Ende.
Das
Regensburger
Publikum
lacht.
Das klärende
Gespräch
zwischen
Tony und
Thomas über
das
Fehlverhalten
des Herrn
Permaneder
findet nach
Tonys
Rückkehr aus
München im
Off statt,
ein Teil des
Dialogs wird
per 'public
address'
eingespielt,
dann auf der
Szene
fortgesetzt.
Die
Geschwister
diskutieren,
was ein
Skandal sei,
dass Tony
auch diese
Ehe aufgebe
oder dass
man sich,
ohne zu
klagen,
fügen müsse.
Einspielung:
'Oh, sink
hernieder' -
Tony: "Gerda
spielt - wie
himmlisch!"
Mutter
Konsulin
meint, die
viele Musik
sei nicht
gut für den
Jungen, sie
ziehe den
Jungen zu
sehr auf
ihre Seite.
Thomas /
Paul Kaiser
kritisiert
laut die
Entnahme von
127.500, die
von der
Mutter an
die Kirche
gegeben
wurden, sie
habe damit
verwirrt und
vernunftlos
gehandelt.
Die
Geschäfte
gehen
schlecht, er
sei
zweiundvierzig
und ein
ermatteter
Mann.
In einem
hysterischen
Anfall, er
sei nur ein
Schauspieler,
weist er die
Regensburger
darauf hin:
'seht her,
ich spiele -
das ist:
Zeigefingertheater!'
Szenenwechsel
Gerda mahnt
den Leutnant
/
Musiklehrer
Markus
Boniberger,
er ginge bei
Hanno mit
dem
Unterricht
zu weit -
der wiederum
ist der
Auffassung,
Hanno
verdiene
diese
Unterweisung,
in seinen
Augen läge
so vieles.
Später werde
Hanno seinen
Mund
möglicherweise
verschließen,
da müsse er
über die
Musik die
Möglichkeit
haben, zu
reden.
Szenenwechsel
Hanno kommt,
er solle
seinem Vater
Thomas das
Gedicht noch
einmal
aufsagen.
Dem Jungen
gelingt es
nicht.
Völlig
verschüchtert
nimmt er
eine vom
Vater als
unkorrekte
kritisierte
Körperhaltung
ein, spricht
so leise,
dass er sich
selber nicht
hört -
geschweige
denn die
Leute ab der
ersten
Reihe.
Der Vater
brüllt, das
Kind weint.
Ein Bild des
Jammers.
Vater Thomas
zitiert
selber
'Schäfers
Sonntagslied'
von Ludwig
Uhland -
senkt den
Kopf, beugt
sich vor:
'Seht her,
ich weine!'
Eingespieltes
Piano mit
'Götterdämmerung-Trauermarsch'!
'Ach und
weh!'
Ein Nieser,
unüberhörbar.
Schneuzen
und
Naseputzen
im Publikum.
"Der
Tod ist ein
Glück! ...
Es ist so
leuchtend
klar!"
Szenenwechsel
Tony legt
einen Strauß
Lilien an
die Rampe.
Mutter
Konsulin ist
gestorben.
Im
Hintergrund
Thomas,
Gerda - mit
Schultertuch,
damit man
nicht sehe,
sie hat noch
immer das
Kleid vom
ersten
Auftritt an
- und Hanno
- er singt,
mehr
schlecht als
recht: "Wer
nur den
lieben Gott
lässt walten
..."
Versuch der
Verteilung
des Erbes
von Mutter
Konsulin -
Christian
kommt, er
habe noch
keine Zeit
gehabt,
schwarze
Knöpfe zu
kaufen, er
beansprucht
Geschirr, er
wolle
heiraten und
habe nur
Mutters Tod
abgewartet.
Thomas will
dafür
sorgen, dass
Christian
das Erbe der
Konsulin
nicht
verlottere.
Bevor die
Auseinandersetzung
eskaliert,
geht Gerda
mit Hanno
nach rechts
ab. Thomas
und
Christian
streiten,
wer von
beiden
kränker sei
und man
werde ja
sehen, wer
von beiden
früher
sterbe.
Christian
lässt sich
zu Boden
fallen,
Thomas wird
ihm
gegenüber
handgreiflich.
"Ich
mache dich
zunichte!"
Die Frage,
was aus dem
Haus wird.
Thomas will
es
ausgerechnet
an
Hagenström
verkaufen,
Tony will
sich nicht
vom Haus
trennen, es
sei immer
der sichere
Hafen
gewesen, ein
Ort, an dem
sie geborgen
war. Auch
wäre dann
für alle
klar:
Buddenbrooks
sind am
Ende.
So sei es
nun mal auch
denen
gegangen,
die das Haus
hergeben
mussten, als
Großvater
Buddenbrook
es kaufte.
Beide ab.
Szenenwechsel
Im
Hindergrund
ertönen
Violine und
Klavier: 2.
Akt Tristan.
Thomas und
Hanno - der
Leutnant sei
schon zwei
Stunden bei
der Mutter.
Der Vater
fragt, ob
der Sohn
bereit sei,
die Firma zu
übernehmen,
ob er
entschlossen
sei. Der
Junge
bejaht. Der
Vater
fordert Mut
ein.
Hanno solle
darauf
achten, dass
der Vater
nicht
gestört
werde.
Gerda kommt
mit dem
Leutnant und
fragt, warum
Hanno nicht
komme und
warum er da
an der Ecke
stehe, was
hinter der
Tür sei.
Thomas mit
dem
Familienbuch,
ein Strich,
ein sauberer
Doppelstrich
direkt unter
dem
Stammbaum -
wer war es?
Hanno:
"Ich
glaubte, es
käme nichts
mehr!"
Szenenwechsel
Christian im
Rollstuhl.
Thomas ist
ihm auch im
Tod noch
zuvorgekommen.
Man entdeckt
bei der
Darstellung
des
Christian
große
Ähnlichkeit
mit der des
Karlos, den
Roman
Blumenschein
zur gleichen
Zeit am
Theater
Regensburg
spielt.
Dort: "Schon
dreiundzwanzig
Jahre, und
noch nichts
für die
Unsterblichkeit
gethan!"
- ist er der
Unreife, den
Philipp II.
so nicht als
Heerführer
nach
Flandern
schicken
kann, hier
ist er ein
unausgegorener
Flaps
angesichts
des Ablebens
des Vaters
nur nach dem
Lübecker
Theaterplan
fragend: "Was
wird
gespielt?"
Möglicherweise
litt
Christian
Buddenbrook
unter
Neurasthenie,
ein im 19.
Jahrhundert
üblicher
Begriff, ein
Nebeneinander
von
Erregbarkeit
und
Erschöpfung,
das sich in
organischen
Fehlfunktionen
zeigen, aber
auch zu
Depressionen
und Paralyse
bis hin zur
Schizophrenie
führen kann.
Diese
Entwicklung
ist bei der
Darstellung
der Figur
nicht
erkennbar.
Stück und
Rolle enden
in der
'von-Düffel'schen-Buddenbrooks-Bearbeitung'
in
Resignation,
aber bei
vollem
Bewusstsein,
mit dem
"...
ich beuge
mich. Du
hast wieder
einmal recht
bekommen!"
Christians
im Roman
auftretende
Fehlfunktionen
bieten Aline
Puvogel
später die
Möglichkeit,
ihn in eine
Klinik zum
ständigen
Verbleib
einweisen zu
lassen.
Nicht einmal
in Ansätzen
wird das von
Roman
Blumenschein
gezeigt, er
ist ein
alles - auch
sich selbst
- nicht
ernst
nehmender
eingebildet
Kranker, dem
es einfach
zu gut geht.
Irgendwie
erinnert er
an Harald
Schmidt -
nach dessen
eigener
Aussage
Hypochonder
- und die
entsprechend
gespielte
TV-Reklame
für den
Pharmakonzern
HEXAL.
|
|

|
|
|
Fazit:
Szenenumstellungen,
große
Regensburger
Striche in
der schon
eingestrichenen
Fassung des
Thalia-Theaters
Hamburg
reduzieren
die
'von-Düffel'sche-Bearbeitung'
derart, dass
nur
Farbtupfer
zu erkennen
sind, die
kein
vollständiges
Bild
ergeben.
Das Stück
holpert,
stolpert
dahin, ein
roter Faden
ist so nur
schwer zu
entwickeln.
Hinzu kommen
die
schnellen
Wechsel -
manche
Szenen
bestehen nur
aus ein paar
Worten,
dauern nur
Sekunden -
erhöhen das
Tempo, aber
auf diese
Weise, das
Publikum
ohne
Vorkenntnisse,
im
Regensburger
Velodrom:
ratlos.
Hinzu kommt
im Bezug auf
die
Darstellung,
dass
vergessen
wird:
"Sägt auch
nicht zu
viel mit den
Händen durch
die Luft, so
-
sondern
behandelt
alles
gelinde!"
Aber hier
heißt es
unkritisch,
man will
Unkenntnis
ja nicht
zugeben:
'Passt scho
- merkt eh
koaner' -
und man
applaudiert,
nicht gerade
frenetisch,
aber halt
'zwengs der
Gaudi.'
|
|

|
Interessanterweise
gibt das
Theater
Regensburg
bei den am
13. und 16.
2. 2010 auf
Kaufkarten
besuchten
Vorstellungen
nicht
bekannt,
welches der
beiden im
Besetzungszettel
genannten
Kinder
abends als
Hanno auf
der Bühne
steht.
Das passt
zum
'Zigeunerbaron'
am 14.
Februar
2010.
Auf dem mit
dem Programm
verteilten
Besetzungszettel
steht für
Kálmán
Zschuppan -
Ruben Gerson
-
auf der
Bühne
erkennt der
Zuschauer
dann
Seymur
Karimov in
der Rolle
des
Schweinezüchters.
Wie meinte
ein Mitglied
des
Verwaltungsrates
vom Theater
Regensburg:
"Das Haus
wird
dilettantisch
geführt!"
|

*(OB
Johannes
Schaidinger
am
17.3.2005:
"Wir
wollen
mehr
sein
als
die
Metropole
der
Oberpfalz")
|
|
|
|
|
 Dieter
Hansing Dieter
Hansing |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|


|
|


|
|






|
|

|
|
Werbung |
|

|
|
|
|
Werbung |
|
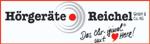
|
|
|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|

|
|
Werbung |
|
|
|

|

|
 |
|










